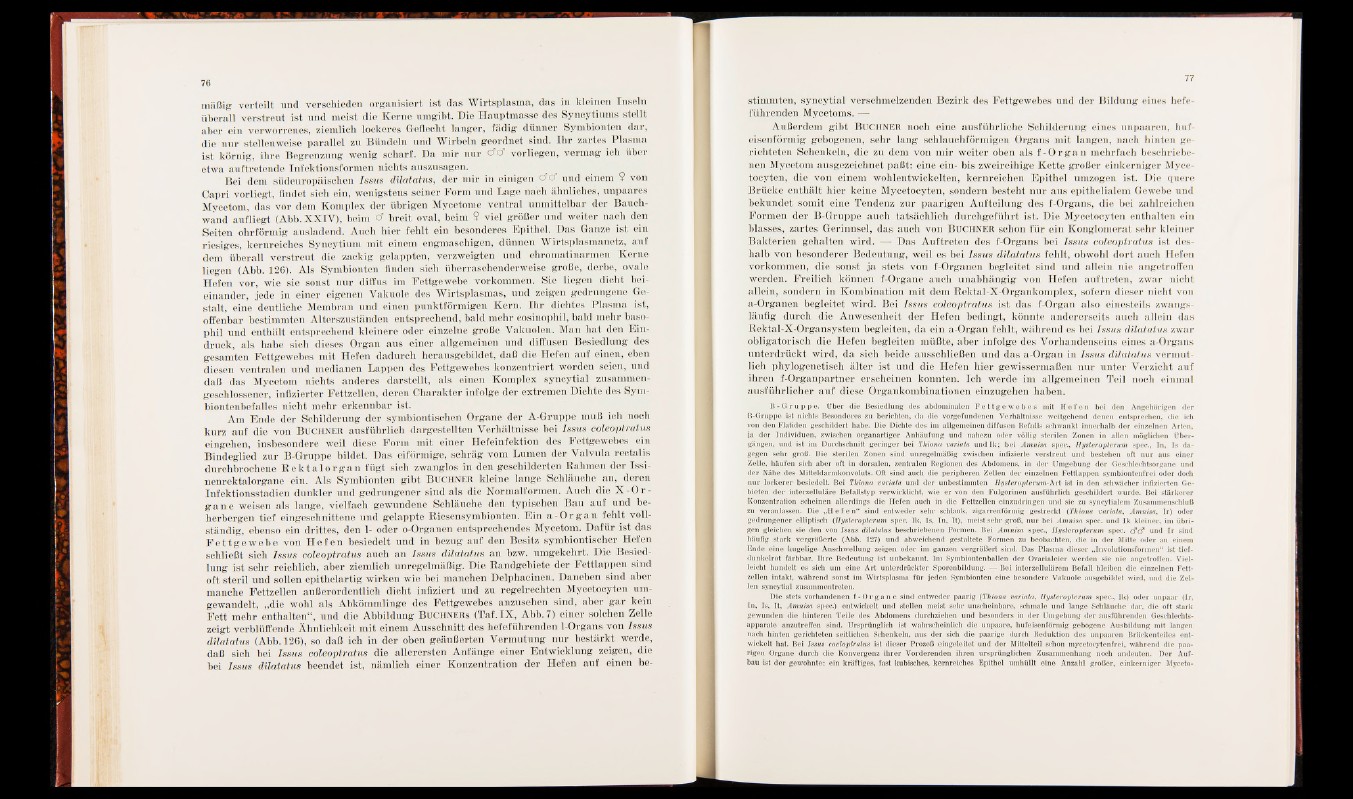
mäßig verteilt und verschieden organisiert ist das Wirtsplasma, das in kleinen Inseln
überall verstreut ist und meist die Kerne umgibt. Die Hauptmasse des Syncytiums stellt
aber ein verworrenes, ziemlich lockeres Geflecht langer, fädig dünner Symbionten dar,
die nur stellenweise parallel zu Bündeln und Wirbeln geordnet sind. Ih r zartes Plasma
ist körnig, ihre Begrenzung wenig scharf. Da mir nur cTgT vorliegen, vermag ich über
etwa auf tretende Infektionsformen nichts auszusagen.
Bei dem südeuropäischen Issus dilatatus, der mir in einigen Gi cf und einem 9 von
Capri vorliegt, findet sich ein, wenigstens seiner Form und Lage nach ähnliches, ünpaäres
Mycetom, das vor dem Komplex der übrigen Mycetome ventral unmittelbar der Bauchwand
aufliegt (Abh. XXIV), heim Cf breit oval, heim ? viel größer und weiter nach den
Seiten ohrförmig ausladend. Auch hier fehlt ein besonderes Epithel. Das Ganze ist ein
riesiges, kernreiches Syncytium mit einem engmaschigen, dünnen Wirtsplasmanetz, auf
dem überall verstreut die zackig gelappten, verzweigten und chromatinarmen Kerne
liegen (Abb. 126). Als Symbionten finden sieh überraschenderweise große, derbe, ovale
Hefen vor, wie sie sonst nur diffus im Fettgewebe Vorkommen. Sie liegen dicht beieinander,
jede in einer eigenen Vakuole des Wirtsplasmas, und zeigen gedrungene Gestalt,
eine deutliche Membran und einen punktförmigen Kern. Ih r dichtes Plasma ist,
offenbar bestimmten Alterszuständen entsprechend, bald mehr eosinophil, bald mehr basophil
und enthält entsprechend kleinere oder einzelne große Vakuolen. Man hat den Eindruck,
als habe sich dieses Organ aus einer allgemeinen und diffusen Besiedlung des
gesamten Fettgewebes mit Hefen dadurch herausgebildet, daß die Hefen auf einen, eben
diesen ventralen und medianen Lappen des Fettgewebes konzentriert worden seien, und
daß das Mycetom nichts anderes darstellt, als einen Komplex syncytial zusammengeschlossener,
infizierter Fettzellen, deren Charakter infolge der extremen Dichte des Sym-
biontenbefalles nicht mehr erkennbar ist.
Am Ende der Schilderung der symhiontischen Organe der A-Gruppe muß ich noch
kurz auf die von B ü c h n e r ausführlich dargestellten Verhältnisse hei Issus coleoptratus
eingehen, insbesondere weil diese Form mit einer Hefeinfektion des Fettgewebes ein
Bindeglied zur B-Gruppe bildet. Das eiförmige, schräg vom Lumen der Valvula reetalis
durchbrochene R e k t a l o r g a n fügt sich zwanglos in den geschilderten Rahmen der Issi-
nenrektalorgane ein. Als Symbionten gibt B ü c h n e r kleine lange Schläuche an, deren
Infektionsstadien dunkler und gedrungener sind als die Normalformen. Auch die X- Or -
g a n e weisen als lange, vielfach gewundene Schläuche den typischen Bau auf und beherbergen
tief eingeschnittene und gelappte Riesensymbionten. Ein a -Or g a n fehlt vollständig,
ebenso ein drittes, den 1- oder o-Organen entsprechendes Mycetom. Dafür ist das
F e t t g ew e b e von He f e n besiedelt und in bezug auf den Besitz symbiontischer Hefen
schließt sich Issus coleoptratus auch an Issus dilatatus an bzw. umgekehrt. Die Besiedlung
ist sehr reichlich, aber ziemlich unregelmäßig. Die Randgebiete der Fettlappen sind
oft steril und sollen epithelartig wirken wie bei manchen Delphacinen. Daneben sind aber
manche Fettzellen außerordentlich dicht infiziert und zu regelrechten Mycetocyten umgewandelt,
„die wohl als Abkömmlinge des Fettgewebes anzusehen sind, aber gar kein
Fe tt mehr enthalten“, und die Abbildung B ü ch n er s (Taf. IX, Abb. 7) einer solchen Zelle
zeigt verblüffende Ähnlichkeit mit einem Ausschnitt des hefeführenden 1-Organs von Issus
dilatatus (Abb. 126), so daß ich in der oben geäußerten Vermutung nur bestärkt werde,
daß sich bei Issus coleoptratus die allerersten Anfänge einer Entwicklung zeigen, die
bei Issus dilatatus beendet ist, nämlich einer Konzentration der Hefen auf einen bestimmten,
syncytial verschmelzenden Bezirk des Fettgewebes und der Bildung eines hefeführenden
Mycetoms. —
Außerdem gibt B ü c h n e r noch eine ausführliche Schilderung eines unpaaren, hufeisenförmig
gebogenen, sehr lang schlauchförmigen Organs mit langen, nach hinten gerichteten
Schenkeln, die zu dem von mir weiter oben als f -Or g a n mehrfach beschriebenen
Mycetom ausgezeichnet paßt: eine ein- bis zweireihige Kette großer einkerniger Mycetocyten,
die von einem wohlentwickelten, kernreichen Epithel umzogen ist. Die quere
Brücke enthält hier keine Mycetocyten, sondern besteht nur aus epithelialem Gewebe und
bekundet somit eine Tendenz zur paarigen Aufteilung des f-Organs, die bei zahlreichen
Formen der B-Gruppe auch tatsächlich durchgeführt ist. Die Mycetocyten enthalten ein
blasses, zartes Gerinnsel, das auch von BÜCHNER schon fü r ein Konglomerat sehr kleiner
Bakterien gehalten wird. — Das Auftreten des f-Organs bei Issus coleoptratus ist deshalb
von besonderer Bedeutung, weil es bei Issus dilatatus fehlt, obwohl dort auch Hefen
Vorkommen, die sonst ja stets von f-Organen begleitet sind und allein nie angetroffen
werden. Freilich können f-Organe auch unabhängig von Hefen auftreten, zwar nicht
allein, sondern in Kombination mit dem Rektal-X-Organkomplex, sofern dieser nicht von
a-Organen begleitet wird. Bei Issus coleoptratus ist das f-Organ also einesteils zwangsläufig
durch die Anwesenheit der Hefen bedingt, könnte andererseits auch allein das
Rektal-X-Organsystem begleiten, da ein a-Organ fehlt, während es bei Issus dilatatus zwar
obligatorisch die Hefen begleiten müßte, aber infolge des Vorhandenseins eines a-Organs
unterdrückt wird, da sich beide ausschließen und das a-Organ in Issus dilatatus vermutlich
phylogenetisch älter ist und die Hefen hier gewissermaßen nur unter Verzicht auf
ihren f-Organpartner erscheinen konnten. Ich werde im allgemeinen Teil noch einmal
ausführlicher auf diese Organkombinationen einzugehen haben.
B-Gr u p p e . Über die Besiedlung des abdominalen F e t t g e w e b e s mit He f e n bei den Angehörigen der
B-Gruppe ist nichts Besonderes zu berichten, da die Vorgefundenen Verhältnisse weitgehend denen entsprechen, die ich
von den Flatiden geschildert habe. Die Dichte des im allgemeinen diffusen Befalls schwankt innerhalb der einzelnen Arten,
ja der Individuen, zwischen organartiger Anhäufung und nahezu oder völlig sterilen Zonen in allen möglichen Übergängen,
und ist im Durchschnitt geringer bei Thiona variata undlk; bei ^4mra's« spec., Hysteropterum spec., In, Is dagegen
sehr groß. Die sterilen Zonen sind unregelmäßig zwischen infizierte verstreut und bestehen oft nur aus einer
Zelle, häufen sich aber oft in dorsalen, zentralen Regionen des Abdomens, in der Umgebung der Geschlechtsorgane und
der Nähe des Mitteldarmkonvoluts. Oft sind auch die peripheren Zellen der einzelnen Fettlappen symbiontenfrei oder doch
nur lockerer besiedelt. Bei Thiona variata und der unbestimmten Hysteropterum-Art- ist in den schwächer infizierten Gebieten
der interzelluläre Befallstyp verwirklicht, wie er von den Fulgorinen ausführlich geschildert wurde. Bei stärkerer
Konzentration scheinen allerdings die Hefen auch in die Fettzellen einzudringen und sie zu syncytialem Zusammenschluß
zu veranlassen. Die „He f e n“ sind entweder sehr schlank, zigarrenförmig gestreckt (Thiona variata, Amnisa, Ir) oder
gedrungener elliptisch (Hysteropterum spec. Ik, Is, In, It), meist sehr groß, nur bei Amnisa spec. und Ik kleiner, im übrigen
gleichen sie den von Issus dilatatus beschriebenen Formen. Bei Amnisa spec., Hysteropterum spec. cfd* und Ir sind
häufig stark vergrößerte (Abb. 127) und abweichend gestaltete Formen zu beobachten, die in der Mitte oder an einem
Ende eine kugelige Anschwellung zeigen oder im ganzen vergrößert sind. Das Plasma dieser „Involutionsfonnen“ ist tiefdunkelrot
färbbar. Ihre Bedeutung ist unbekannt. Im Symbiontenballen der Ovarialeier werden sie nie angetroffen. Vielleicht
handelt es sich um eine Art unterdrückter Sporenbildung. — Bei interzellulärem Befall bleiben die einzelnen Fettzellen
intakt, während sonst im Wirtsplasma für jeden Symbionten eine besondere Vakuole ausgebildet wird, und die Zellen
syncytial zusammentreten.
Die stets vorhandenen f -Or g a n e sind entweder paarig (Thiona variata, Hysteropterum spec., Ik) oder unpaar (Ir,
In, Is, It, Amnisa spec.) entwickelt und stellen meist sehr unscheinbare, schmale und lange Schläuche dar, die oft stark
gewunden die hinteren Teile des Abdomens durchziehen und besonders in der Umgebung der ausführenden Geschlechtsapparate
anzutreffen sind. Ursprünglich ist wahrscheinlich die unpaare, hufeisenförmig gebogene Ausbildung mit langen
nach hinten gerichteten seitlichen Schenkeln, aus der sich die paarige durch Reduktion des unpaaren Brückenteiles entwickelt
hat. Bei Issus coeloptralus ist dieser Prozeß eingeleitet und der Mittelteil schon mycetocytenfrei, während die paarigen
Organe durch die Konvergenz ihrer Vorderenden ihren ursprünglichen Zusammenhang noch andeuten. Der Aufbau
ist der gewohnte: ein kräftiges, fast kubisches, kernreiches Epithel umhüllt eine Anzahl großer, einkerniger Myceto