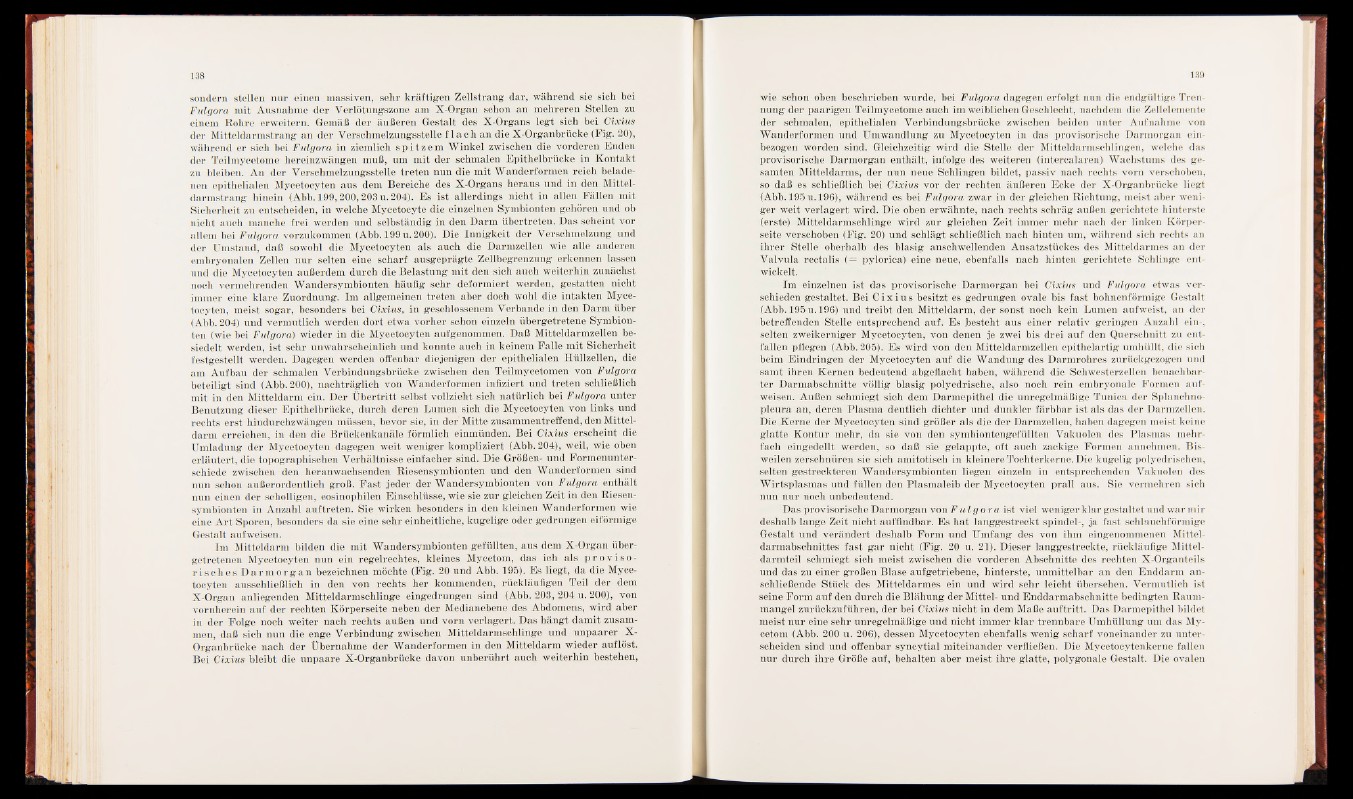
sondern stellen nur einen massiven, sehr kräftigen Zellstrang dar, während sie sich bei
Fulgora mit Ausnahme der Verlötungszone am X-Organ schon an mehreren Stellen zu
einem Rohre erweitern. Gemäß der äußeren Gestalt des X-Organs legt sich bei Cixius
der Mitteldarmstrang an der Verschmelzungsstelle f l a c h an die X-Organbrücke (Fig. 20),
während er sich bei Fulgora in ziemlich s p i t z e m Winkel zwischen die vorderen Enden
der Teilmycetome hereinzwängen muß, um mit der schmalen Epithelbrücke in Kontakt
zu bleiben. An der Verschmelzungsstelle treten nun die mit Wanderformen reich beladenen
epithelialen Mycetocyten aus dem Bereiche des X-Organs heraus und in den Mitteldarmstrang
hinein (Abb. 199,200,203 u. 204). Es ist allerdings nicht in allen Fällen mit
Sicherheit zu entscheiden, in welche Mycetocyte die einzelnen Symbionten gehören und ob
nicht auch manche frei werden und selbständig in den Darm übertreten. Das scheint vor
allem bei Fulgora vorzukommen (Abb. 199 u. 200). Die Innigkeit der Verschmelzung und
der Umstand, daß sowohl die Mycetocyten als auch die Darmzellen wie alle anderen
embryonalen Zellen nur selten eine scharf ausgeprägte Zellbegrenzung erkennen lassen
und die Mycetocyten außerdem durch die Belastung mit den sich auch weiterhin zunächst
noch vermehrenden Wandersymbionten häufig sehr deformiert werden, gestatten nicht
immer eine klare Zuordnung. Im allgemeinen treten aber doch wohl die intakten Mycetocyten,
meist sogar, besonders bei Cixius, in geschlossenem Verbände in den Darm über
(Abb. 204) und vermutlich werden dort etwa vorher schon einzeln ühergetretene Symbionten
(wie hei Fulgora) wieder in die Mycetocyten aufgenommen. Daß Mitteldarmzellen besiedelt
werden, ist sehr unwahrscheinlich und konnte auch in keinem Falle mit Sicherheit
festgestellt werden. Dagegen werden offenbar diejenigen der epithelialen Hüllzellen, die
am Aufbau der schmalen Verbindungsbrücke zwischen den Teilmycetomen von Fulgora
beteiligt sind (Abb. 200), nachträglich von Wanderformen infiziert und treten schließlich
mit in den Mitteldarm ein. Der Übertritt selbst vollzieht sich natürlich bei Fulgora unter
Benutzung dieser Epithelbrücke, durch deren Lumen sich die Mycetocyten von links und
rechts erst hindurchzwängen müssen, bevor sie, in der Mitte zusammentreffend, den Mitteldarm
erreichen, in den die Brückenkanäle förmlich einmünden. Bei Cixius erscheint die
Umladung der Mycetocyten dagegen weit weniger kompliziert (Abb. 204), weil, wie oben
erläutert, die topographischen Verhältnisse einfacher sind. Die Größen- und Formenunterschiede
zwischen den heranwachsenden Riesensymbionten und den Wanderformen sind
nun schon außerordentlich groß. Fa st jeder der Wandersymbionten von Fulgora enthält
nun einen der scholligen, eosinophilen Einschlüsse, wie sie zur gleichen Zeit in den Riesensymbionten
in Anzahl auftreten. Sie wirken besonders in den kleinen Wanderformen wie
eine Art Sporen, besonders da sie eine sehr einheitliche, kugelige oder gedrungen eiförmige
Gestalt auf weisen.
Im Mitteldarm bilden die mit Wandersymbionten gefüllten, aus dem X-Organ übergetretenen
Mycetocyten nun ein regelrechtes, kleines Mycetom, das ich als p r o v i s o r
i s c h e s D a rm o r g a n bezeichnen möchte (Fig. 20 und Abb. 195). Es liegt, da die Mycetocyten
ausschließlich in den von rechts her kommenden, rückläufigen Teil der dem
X-Organ anliegenden Mitteldarmschlinge eingedrungen sind (Abb. 203, 204 u. 200), von
vornherein auf der rechten Körperseite neben der Medianebene des Abdomens, wird aber
in der Folge noch weiter nach rechts außen und vorn verlagert. Das hängt damit zusammen,
daß sich nun die enge Verbindung zwischen Mitteldarmschlinge und unpaarer X-
Organhrücke nach der Übernahme der Wanderformen in den Mitteldarm wieder auf löst.
Bei Cixius bleibt die unpaare X-Organbrücke davon unberührt auch weiterhin bestehen,
wie schon oben beschrieben wurde, bei Fulgora dagegen erfolgt nun die endgültige Trennung
der paarigen Teilmycetome auch im weiblichen Geschlecht, nachdem die Zellelemente
der schmalen, epithelialen Verbindungsbrücke zwischen beiden unter Aufnahme von
Wanderformen und Umwandlung zu Mycetocyten in das provisorische Darmorgan einbezogen
worden sind. Gleichzeitig wird die Stelle der Mitteldarmschlingen, welche das
provisorische Darmorgan enthält, infolge des weiteren (intercalaren) Wachstums des gesamten
Mitteldarms, der nun neue Schlingen bildet, passiv nach rechts vorn verschoben,
so daß es schließlich bei Cixius vor der rechten äußeren Ecke der X-Organbrücke liegt
(Abb. 195 u. 196), während es bei Fulgora zwar in der gleichen Richtung, meist aber weniger
weit verlagert wird. Die oben erwähnte, nach rechts schräg außen gerichtete hinterste
(erste) Mitteldarmschlinge wird zur gleichen Zeit immer mehr nach der linken Körperseite
verschoben (Fig. 20) und schlägt schließlich nach hinten um, während sich rechts an
ihrer Stelle oberhalb des blasig anschwellenden Ansatzstückes des Mitteldarmes an der
Valvula rectalis | | f pylorica) eine neue, ebenfalls nach hinten gerichtete Schlinge entwickelt.
Im einzelnen ist das provisorische Darmorgan hei Cixius und Fulgora etwas verschieden
gestaltet. Bei C i x i u s besitzt es gedrungen ovale bis fast bohnenförmige Gestalt
(Abh. 195 u. 196) und treibt den Mitteldarm, der sonst noch kein Lumen aufweist, an der
betreffenden Stelle entsprechend auf. Es .besteht aus einer relativ geringen Anzahl ein-,
selten zweikerniger Mycetocyten, von denen je zwei bis drei auf den Querschnitt zu entfallen
pflegen (Abb. 205). Es wird von den Mitteldarmzellen epithelartig umhüllt, die sich
beim Eindringen der Mycetocyten auf die Wandung des Darmrohres zurückgezogen und
samt ihren Kernen bedeutend abgeflacht haben, während die Schwesterzellen benachbarter
Darmahschnitte völlig blasig polyedrische, also noch rein embryonale Formen aufweisen.
Außen schmiegt sich dem Darmepithel die unregelmäßige Tunica der Splanchno-
pleura an, deren Plasma deutlich dichter und dunkler färbhar ist als das der Darmzellen.
Die Kerne der Mycetocyten sind größer als die der Darmzellen, haben dagegen meist keine
glatte Kontur mehr, da sie von den symbiontengefüllten Vakuolen des Plasmas mehrfach
eingedellt werden, so daß sie gelappte, oft auch zackige Formen annehmen. Bisweilen
zerschnüren sie sich amitotisch in kleinere Tochterkerne. Die kugelig polyedrischen,
selten gestreckteren Wandersymbionten liegen einzeln in entsprechenden Vakuolen des
Wirtsplasmas und füllen den Plasmaleib der Mycetocyten prall aus. Sie vermehren sich
nun nur noch unbedeutend.
Das provisorische Darmorgan von F u l g o r a ist viel weniger klar gestaltet und war mir
deshalb lange Zeit nicht auffindbar. Es hat langgestreckt spindel-, ja fast schlauchförmige
Gestalt und verändert deshalb Form und Umfang des von ihm eingenommenen Mitteldarmabschnittes
fast gar nicht (Fig. 20 u. 21). Dieser langgestreckte, rückläufige Mitteldarmteil
schmiegt sich meist zwischen die vorderen Abschnitte des rechten X-Organteils
und das zu einer großen Blase aufgetriebene, hinterste, unmittelbar an den Enddarm anschließende
Stück des Mitteldarmes ein und wird sehr leicht übersehen. Vermutlich ist
seine Form auf den durch die Blähung der Mittel- und Enddarmabschnitte bedingten Raummangel
zurückzuführen, der hei Cixius nicht in dem Maße auftritt. Das Darmepithel bildet
meist nur eine sehr unregelmäßige und nicht immer klar trennbare Umhüllung um das Mycetom
(Abb. 200 u. 206), dessen Mycetocyten ebenfalls wenig scharf voneinander zu unterscheiden
sind und offenbar syncytial miteinander verfließen. Die Mycetocytenkerne fallen
nur durch ihre Größe auf, behalten aber meist ihre glatte, polygonale Gestalt. Die ovalen