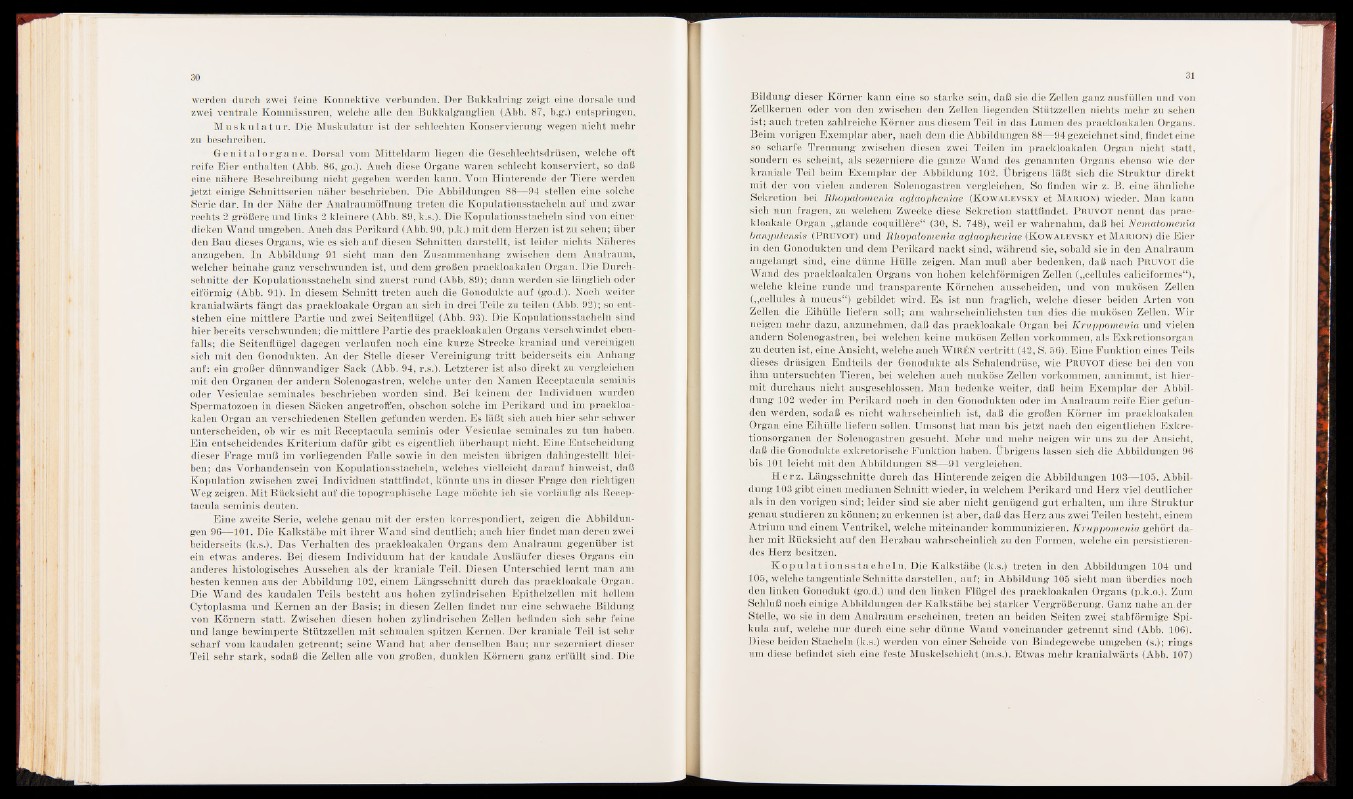
werden durch zwei feine Konnektive verbunden. Der Bukkalring zeigt eine dorsale und
zwei ventrale Kommissuren, welche alle den Bukkalganglien (Abb. 87, b.g.) entspringen..
M u s k u l a t u r . Die Muskulatur ist der schlechten Konservierung wegen nicht mehr
zu beschreiben.
G e n i t a l o r g a n e . Dorsal vom Mitteldarm liegen die Geschlechtsdrüsen, welche oft
reife Eier enthalten (Abb. 86, go.). Auch diese Organe waren schlecht konserviert, so daß
eine nähere Beschreibung nicht gegeben werden kann. Vom Hinter ende der Tiere werden
jetzt einige Schnittserien näher beschrieben. Die Abbildungen 88—94 stellen eine solche
Serie dar. In der Nähe der Analraumöffnung treten die Kopulationsstacheln auf und zwar
rechts 2 größere und links 2 kleinere (Abb. 89, k.s.). Die Kopulationsstacheln sind von einer
dicken Wand umgeben. Auch das Perikard (Abb. 90, p.k.) mit dem Herzen ist zu sehen; über
den Bau dieses Organs, wie es sich auf diesen Schnitten darstellt, ist leider nichts Näheres
anzugeben. In Abbildung 91 sieht man den Zusammenhang zwischen dem Analraum,
welcher beinahe ganz verschwunden ist, und dem großen praekloakalen Organ. Die Durchschnitte
der Kopulationsstacheln sind zuerst rund (Abb. 89); dann werden sie länglich oder
eiförmig (Abb. 91). In diesem Schnitt treten auch die Gonodukte auf (go.d.). Noch weiter
kranialwärts fängt das praekloakale Organ an sich in drei Teile zu teilen (Abb. 92); so entstehen
eine mittlere Partie und zwei Seitenflügel (Abb. 93). Die Kopulationsstacheln sind
hier bereits verschwunden; die mittlere Pa rtie des praekloakalen Organs verschwindet ebenfalls;
die Seitenflügel dagegen verlaufen noch eine kurze Strecke kraniad und vereinigen
sich mit den Gonodukten. An der Stelle dieser Vereinigung tritt beiderseits ein Anhang
auf: ein großer dünnwandiger Sack (Abb. 94, r.s.). Letzterer ist also direkt zu vergleichen
mit den Organen der ändern Solenogastren, welche unter den Namen Reeeptacula seminis
oder Vesiculae seminales beschrieben worden sind. Bei keinem der Individuen wurden
Spermatozoen in diesen Säcken angetroffen, obschon solche im Perikard und im praekloakalen
Organ an verschiedenen Stellen gefunden werden. Es läßt sich auch hier sehr schwer
unterscheiden, ob wir es mit Reeeptacula seminis oder Vesiculae seminales zu tun haben.
Ein entscheidendes Kriterium dafür gibt es eigentlich überhaupt nicht. Eine Entscheidung
dieser Frage muß im vorliegenden Falle sowie in den meisten übrigen dahingestellt bleiben;
das Vorhandensein von Kopulationsstacheln, welches vielleicht darauf hinweist, daß
Kopulation zwischen zwei Individuen stattfindet, könnte uns in dieser Frage den richtigen
Weg zeigen. Mit Rücksicht auf die topographische Lage möchte ich sie vorläufig als Recep-
tacula seminis deuten.
Eine zweite Serie, welche genau mit der ersten korrespondiert, zeigen die Abbildungen
96—101. Die Kalkstäbe mit ihrer Wand sind deutlich; auch hier findet man deren zwei
beiderseits (k.s.). Das Verhalten des praekloakalen Organs dem Analraum gegenüber ist
ein etwas anderes. Bei diesem Individuum hat der kaudale Ausläufer dieses Organs ein
anderes histologisches Aussehen als der kraniale Teil. Diesen Unterschied lernt man am
besten kennen aus der Abbildung 102, einem Längsschnitt durch das praekloakale Organ.
Die Wand des kaudalen Teils besteht aus hohen zylindrischen Epithelzellen mit hellem
Cytoplasma und Kernen an der Basis; in diesen Zellen findet nur eine schwache Bildung
von Körnern statt. Zwischen diesen hohen zylindrischen Zellen befinden sich sehr feine
und lange bewimperte Stützzellen mit schmalen spitzen Kernen. Der kraniale Teil ist sehr
scharf vom kaudalen getrennt; seine Wand hat aber denselben Bau; nur sezerniert dieser
Teil sehr stark, sodaß die Zellen alle von großen, dunklen Körnern ganz erfüllt sind. Die
Bildung dieser Körner kann eine so starke sein, daß sie die Zellen ganz ausfüllen und von
Zellkernen oder von den zwischen den Zellen liegenden Stützzellen nichts mehr zu sehen
ist; auch treten zahlreiche Körner aus diesem Teil in das Lumen des praekloakalen Organs.
Beim vorigen Exemplar aber, nach dem die Abbildungen 88-—94 gezeichnet sind, findet eine
so scharfe Trennung zwischen diesen zwei Teilen im praekloakalen Organ nicht statt,
sondern es scheint, als sezerniere die ganze Wand des genannten Organs ebenso wie der
kraniale Teil beim Exemplar der Abbildung 102. Übrigens laßt sich die Struktur direkt
mit der von vielen anderen Solenogastren vergleichen. So finden wir z. B. eine ähnliche
Sekretion bei Rhopalomenia aglaopheniae (K owalevsky et Ma r io n ) wieder. Man kann
sich nun fragen, zu welchem Zwecke diese Sekretion stattfindet. P r u v o t nennt das praekloakale
Organ „glande coquillöre“ (30, S. 748), weil er wahrnahm, daß bei Nematomenia
banyulensis (P ru v o t ) und Rhopalomenia aglaopheniae (K owalevsky et Ma r io n ) die Eier
in den Gonodukten und dem Perikard nackt sind, während sie, sobald sie in den Analraum
angelangt sind, eine dünne Hülle zeigen. Man muß aber bedenken, daß nach P ru v o t die
Wand des praekloakalen Organs von hohen kelchförmigen Zellen („cellules caliciformes“),
welche kleine runde und transparente Körnchen ausscheiden, und von mukösen Zellen
■¡¡Lcellules ä mucus“) gebildet wird. Es ist nun fraglich, welche dieser beiden Arten von
Zellen die Eihülle liefern soll; am wahrscheinlichsten tun dies die mukösen Zellen. Wir
neigen mehr dazu, anzunehmen, daß das praekloakale Organ bei Kruppomenia und vielen
ändern Solenogastren, bei welchen keine mukösen Zellen Vorkommen, als Exkretionsorgan
zu deuten ist, eine Ansicht, welche auch W ir e n v e rtritt (42, S. 56). Eine Funktion eines Teils
dieses drüsigen Endteils der Gonodukte als Schalendrüse, wie P ru v o t diese bei den von
ihm untersuchten Tieren, bei welchen auch muköse Zellen Vorkommen, annimmt, ist hiermit
durchaus nicht ausgeschlossen. Man bedenke weiter, daß beim Exemplar der Abbildung
102 weder im Perikard noch in den Gonodukten oder im Analraum reife Eier gefunden
werden, sodaß es nicht wahrscheinlich ist, daß die großen Körner im praekloakalen
Organ eine Eihülle liefern sollen. Umsonst hat man bis jetzt nach den eigentlichen Exkretionsorganen
der Solenogastren gesucht. Mehr und mehr neigen wir uns zu der Ansicht,
daß die Gonodukte exkretorische Funktion haben. Übrigens lassen sich die Abbildungen 96
bis 101 leicht mit den Abbildungen 88— 91 vergleichen.
He r z . Längsschnitte durch das Hinterende zeigen die Abbildungen 103— 105. Abbildung
103 gibt einen medianen Schnitt wieder, in welchem Perikard und Herz viel deutlicher
als in den vorigen sind; leider sind sie aber nicht genügend gut erhalten, um ihre Struktur
genau studieren zu können; zu erkennen ist aber, daß das Herz aus zwei Teilen besteht, einem
Atrium und einem Ventrikel, welche miteinander kommunizieren. Kruppomenia gehört daher
mit Rücksicht auf den Herzbau wahrscheinlich zu den Formen, welche ein persistierendes
Herz besitzen.
K o p u l a t i o n s s t a c h e l n . Die Kalkstäbe (k.s.) treten in den Abbildungen 104 und
105, welche tangentiale Schnitte darstellen, auf; in Abbildung 105 sieht man überdies noch
den linken Gonodukt (go.d.) und den linken Flügel des praekloakalen Organs (p.k.o.). Zum
Schluß noch einige Abbildungen der Kalkstäbe bei starker Vergrößerung. Ganz nahe an. der
Stelle, wo sie in dem Analraum erscheinen, treten an beiden Seiten zwei stabförmige Spi-
kula auf, welche nur durch eine sehr dünne Wand voneinander getrennt sind (Abb. 106).
Diese beiden Stacheln (k.s.) werden von einer Scheide von Bindegewebe umgeben (s.); rings
um diese befindet sich eine feste Muskelschicht (m.s.). Etwas mehr kranialwärts (Abb. 107)