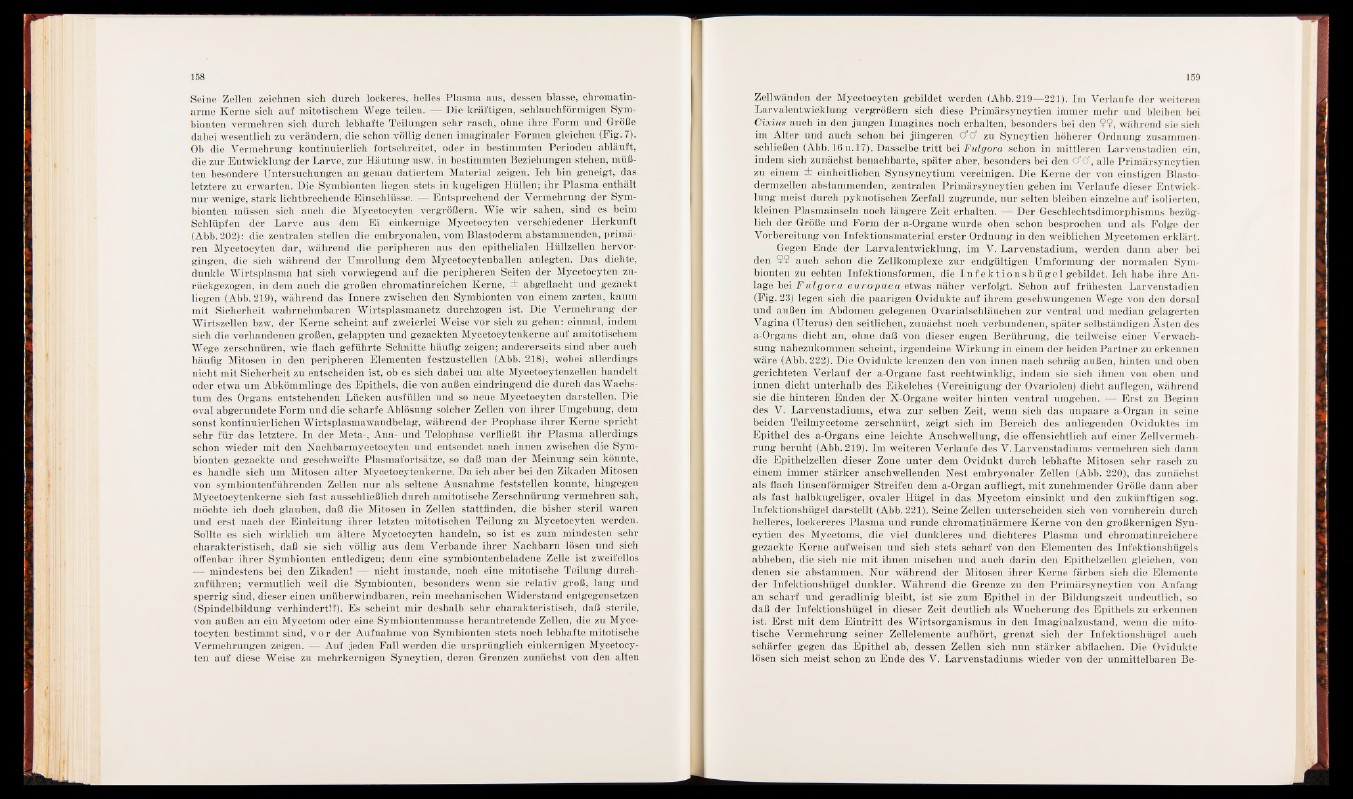
Seine Zellen zeichnen sich durch lockeres, helles Plasma aus, dessen blasse, chromatin-
arme Kerne sich auf mitotischem Wege teilen. — Die kräftigen, schlauchförmigen Sym-
bionten vermehren sich durch lebhafte Teilungen sehr rasch, ohne ihre Form und Größe
dabei wesentlich zu verändern, die schon völlig denen imaginaler Formen gleichen (Fig. 7).
Ob die Vermehrung kontinuierlich fortschreitet, oder in bestimmten Perioden abläuft,
die zur Entwicklung der Larve, zur Häutung usw. in bestimmten Beziehungen stehen, müßten
besondere Untersuchungen an genau datiertem Material zeigen. Ich bin geneigt, das
letztere zu erwarten. Die Symbionten liegen stets in kugeligen Hüllen; ih r Plasma enthält
nur wenige, stark lichtbrechende Einschlüsse. — Entsprechend der Vermehrung der Symbionten
müssen sich auch die Mycetocyten vergrößern. Wie wir sahen, sind es beim
Schlüpfen der Larve aus dem Ei einkernige Mycetocyten verschiedener Herkunft
(Abb. 202): die zentralen stellen die embryonalen, vom Blastoderm abstammenden, primären
Mycetocyten dar, während die peripheren aus den epithelialen Hüllzellen hervorgingen,
die sich während der Umrollung dem Mycetocytenballen anlegten. Das dichte,
dunkle Wirtsplasma ha t sich vorwiegend auf die peripheren Seiten der Mycetocyten zurückgezogen,
in dem auch die großen chromatinreichen Kerne, ± abgeflacht und gezackt
liegen (Abb. 219), während das Innere zwischen den Symbionten von einem zarten, kaum
mit Sicherheit wahrnehmbaren Wirtsplasmanetz durchzogen ist. Die Vermehrung der
Wirtszellen bzw. der Kerne scheint auf zweierlei Weise vor sich zu gehen: einmal, indem
sich die vorhandenen großen, gelappten und gezackten Mycetocytenkerne auf amitotischem
Wege zerschnüren, wie flach geführte Schnitte häufig zeigen; andererseits sind aber auch
häufig Mitosen in den peripheren Elementen festzustellen (Abb. 218), wobei allerdings
nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob es sich dabei um alte Mycetocytenzellen handelt
oder etwa um Abkömmlinge des Epithels, die von außen eindringend die durch das Wachstum
des Organs entstehenden Lücken ausfüllen und so neue Mycetocyten darstellen. Die
oval abgerundete Form und die scharfe Ablösung solcher Zellen von ihrer Umgebung, dem
sonst kontinuierlichen Wirtsplasmawandbelag, während der Prophase ihrer Kerne spricht
sehr für das letztere. In der Meta-, Ana- und Telophase verfließt ihr Plasma allerdings
schon wieder mit den Nachbar mycetocyten und entsendet nach innen zwischen die Symbionten
gezackte und geschweifte Plasmafortsätze, so daß man der Meinung sein könnte,
es handle sich um Mitosen alter Mycetocytenkerne. Da ich aber bei den Zikaden Mitosen
von symbiontenführenden Zellen nur als seltene Ausnahme feststellen konnte, hingegen
Mycetocytenkerne sich fast ausschließlich durch amitotische Zerschnürung vermehren sah,
möchte ich doch glauben, daß die Mitosen in Zellen stattfinden, die bisher steril waren
und erst nach der Einleitung ihrer letzten mitotischen Teilung zu Mycetocyten werden.
Sollte es sich wirklich um ältere Mycetocyten handeln, so ist es zum mindesten sehr
charakteristisch, daß sie sich völlig aus dem Verbände ihrer Nachbarn lösen und sich
offenbar ihrer Symbionten entledigen; denn eine symbiontenbeladene Zelle ist zweifellos
— mindestens bei den Zikaden! — nicht imstande, noch eine mitotische Teilung durchzuführen;
vermutlich weil die Symbionten, besonders wenn sie relativ groß, lang und
sperrig sind, dieser einen unüberwindbaren, rein mechanischen Widerstand entgegensetzen
(Spindelbildung verhindert!?). Es scheint mir deshalb sehr charakteristisch, daß sterile,
von außen an ein Mycetom oder eine Symbiontenmasse herantretende Zellen, die zu Mycetocyten
bestimmt sind, v o r der Aufnahme von Symbionten stets noch lebhafte mitotische
Vermehrungen zeigen. — Auf jeden Fall werden die ursprünglich einkernigen Myeetocy-
ten auf diese Weise zu mehrkernigen Syncytien, deren Grenzen zunächst von den alten
Zellwänden der Mycetocyten gebildet werden (Abb. 219—221). Im Verlaufe der weiteren
Larvalentwicklung vergrößern sich diese Primärsyncytien immer mehr und bleiben bei
Cixius auch in den jungen Imagines noch erhalten, besonders bei den 99, während sie sich
im Alter und auch schon bei jüngeren Ö'cT zu Syncytien höherer Ordnung zusammenschließen
(Abb. 16 u. 17). Dasselbe tritt bei Fulgora schon in mittleren Larvenstadien ein,
indem sich zunächst benachbarte, später aber, besonders bei den CT Cf, alle Primärsyncytien
zu einem ± einheitlichen Synsyncytium vereinigen. Die Kerne der von einstigen Blasto-
dermzellen abstammenden, zentralen Primärsyncytien gehen im Verlaufe dieser Entwicklung
meist durch pyknotischen Zerfall zugrunde, nur selten bleiben einzelne auf isolierten,
kleinen Plasmainseln noch längere Zeit erhalten. — Der Geschlechtsdimorphismus bezüglich
der Größe und Form der a-Organe wurde oben schon besprochen und als Folge der
Vorbereitung von Infektionsmaterial erster Ordnung in den weiblichen Mycetomen erklärt.
Gegen Ende der Larvalentwicklung, im V. Larvenstadium, werden dann aber bei
den 99 auch schon die Zellkomplexe zur endgültigen Umformung der normalen Symbionten
zu echten Infektionsformen, die I n f e k t i o n s h ü g e l gebildet. Ich habe ihre Anlage
bei F u lg o r a e u ro p a e a etwas näher verfolgt. Schon auf frühesten Larvenstadien
(Fig. 23) legen sich die paarigen Ovidukte auf ihrem geschwungenen Wege von den dorsal
und außen im Abdomen gelegenen Ovarialschläuchen zur ventral und median gelagerten
Vagina (Uterus) den seitlichen, zunächst noch verbundenen, später selbständigen Ästen des
a-Organs dicht an, ohne daß von dieser engen Berührung, die teilweise einer Verwachsung
nahezukommen scheint, irgendeine Wirkung in einem der beiden Partn er zu erkennen
wäre (Abb. 222). Die Ovidukte kreuzen den von innen nach schräg außen, hinten und oben
gerichteten Verlauf der a-Organe fast rechtwinklig, indem sie sich ihnen von oben und
innen dicht unterhalb des Eikelches (Vereinigung der Ovariolen) dicht auf legen, während
sie die hinteren Enden der X-Organe weiter hinten ventral umgehen. — E rst zu Beginn
des V. Larvenstadiums, etwa zur selben Zeit, wenn sich das unpaare a-Organ in seine
beiden Teilmycetome zerschnürt, zeigt sich im Bereich des anliegenden Oviduktes im
Epithel des a-Organs eine leichte Anschwellung, die offensichtlich auf einer Zellvermehrung
beruht (Abb. 219). Im weiteren Verlaufe des V. Larvenstadiums vermehren sich dann
die Epithelzellen dieser Zone unter dem Ovidukt durch lebhafte Mitosen sehr rasch zu
einem immer stärker anschwellenden Nest embryonaler Zellen (Abb. 220), das zunächst
als flach linsenförmiger Streifen dem a-Organ aufliegt, mit zunehmender Größe dann aber
als fast halbkugeliger, ovaler Hügel in das Mycetom einsinkt und den zukünftigen sog.
Infektionshügel darstellt (Abb. 221). Seine Zellen unterscheiden sich von vornherein durch
helleres, lockereres Plasma und runde chromatinärmere Kerne von den großkernigen Syncytien
des Mycetoms, die viel dunkleres und dichteres Plasma und chromatinreichere
gezackte Kerne aufweisen und sich stets scharf von den Elementen des Infektionshügels
abheben, die sich nie mit ihnen mischen und auch darin den Epithelzellen gleichen, von
denen sie abstammen. Nur während der Mitosen ihrer Kerne färben sich die Elemente
der Infektionshügel dunkler. Während die Grenze zu den Primärsyncytien von Anfang
an scharf und geradlinig bleibt, ist sie zum Epithel in der Bildungszeit undeutlich, so
daß der Infektionshügel in dieser Zeit deutlich als Wucherung des Epithels zu erkennen
ist. E rst mit dem E in tritt des Wirtsorganismus in den Imaginalzustand, wenn die mitotische
Vermehrung seiner Zellelemente aufhört, grenzt sich der Infektionshügel auch
schärfer gegen das Epithel ab, dessen Zellen sich nun stärker abflachen. Die Ovidukte
lösen sich meist schon zu Ende des V. Larvenstadiums wieder von der unmittelbaren Be