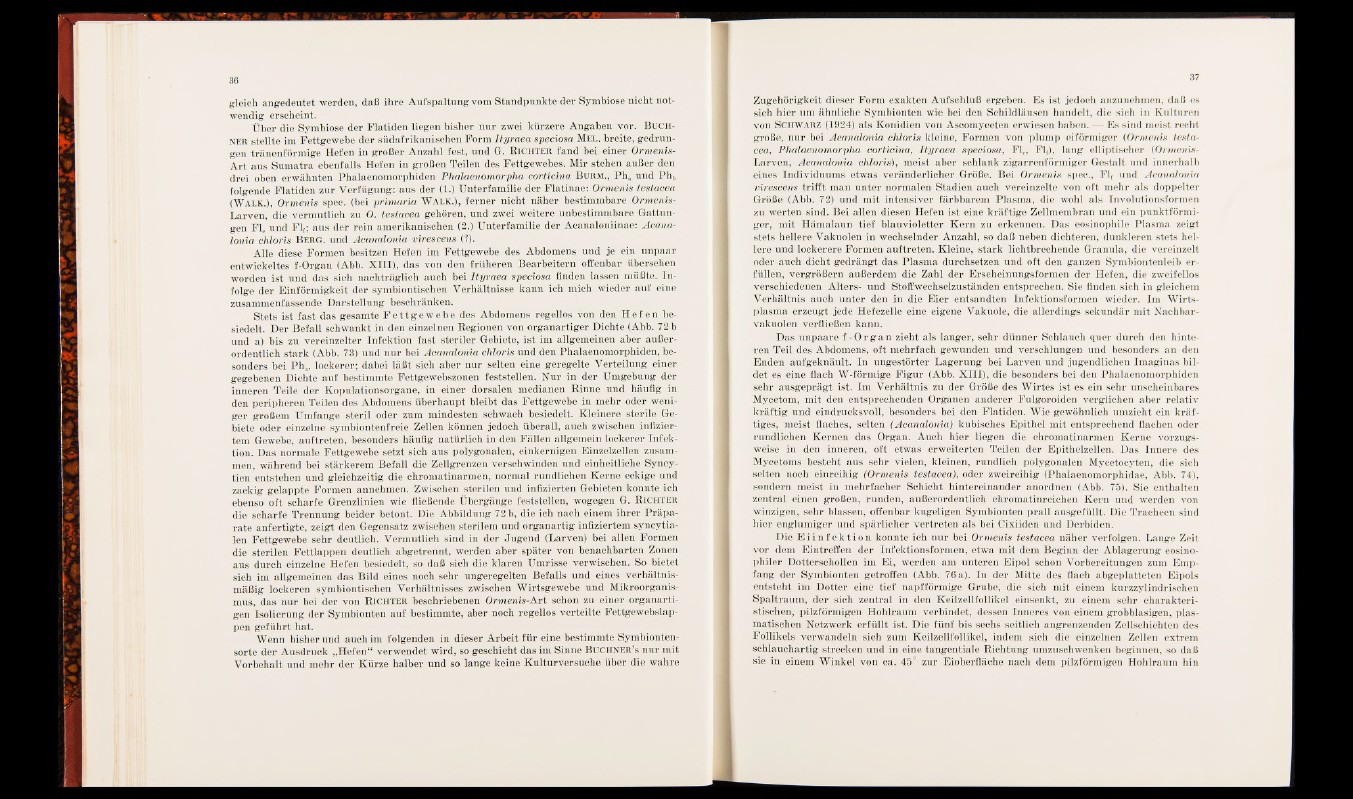
gleich angedeutet werden, daß ihre Aufspaltung vom Standpunkte der Symbiose nicht notwendig
erscheint.
Über die Symbiose der Flatiden liegen bisher nur zwei kürzere Angaben vor. B ü c h n
e r stellte im Fettgewebe der südafrikanischen Form Ityraea speciosa Me l . breite, gedrungen
tränenförmige Hefen in großer Anzahl fest, und G. R ic h t e r fand bei einer Ormenis-
Art aus Sumatra ebenfalls Hefen in großen Teilen des Fettgewebes. Mir stehen außer den
drei oben erwähnten Phalaenomorphiden Phalaenomorpha corticina B u rm ., Ph a und Phb
folgende Flatiden zur Verfügung: aus der (1.) Unterfamilie der Flatinae: Ormenis testacea
(W a lk .), Ormenis spec. (bei primaria W a lk .), ferner nicht näher bestimmbare Ormenis-
Larven, die vermutlich zu 0 . testacea gehören, und zwei weitere unbestimmbare Gattungen
F le und F lf; aus der rein amerikanischen (2.) Unterfamilie der Acanaloniinae: Acana-
lonia chloris B e r g , und Acanalonia virescens (?)•
Alle diese Formen besitzen Hefen im Fettgewebe des Abdomens und je ein unpaar
entwickeltes f-Organ (Abb. X III), das von den früheren Bearbeitern offenbar übersehen
worden ist und das sich nachträglich auch bei Ityraea speciosa finden lassen müßte. In folge
der Einförmigkeit der symbiontischen Verhältnisse kann ich mich wieder auf eine
zusammenfassende Darstellung beschränken.
Stets ist fast das gesamte F e t t g ewe b e des Abdomens regellos von den He f e n besiedelt.
Der Befall schwankt in den einzelnen Regionen von organartiger Dichte (Abb. 72 b
und a) bis zu vereinzelter Infektion fast steriler Gebiete, ist im allgemeinen aber außerordentlich
stark (Abb. 73) und nur bei Acanalonia chloris und den Phalaenomorphiden, besonders
bei Ph a, lockerer; dabei läßt sich aber nur selten eine geregelte Verteilung einer
gegebenen Dichte auf bestimmte Fettgewebszonen feststellen. Nur in der Umgebung der
inneren Teile der Kopulationsorgane, in einer dorsalen medianen Rinne und häufig in
den peripheren Teilen des Abdomens überhaupt bleibt das Fettgewebe in mehr oder weniger
großem Umfange steril oder zum mindesten schwach besiedelt. Kleinere sterile Gebiete
oder einzelne symbiontenfreie Zellen können jedoch überall, auch zwischen infiziertem
Gewebe, auftreten, besonders häufig natürlich in den Fällen allgemein lockerer Infektion.
Das normale Fettgewebe setzt sich aus polygonalen, einkernigen Einzelzellen zusammen,
während bei stärkerem Befall die Zellgrenzen verschwinden und einheitliche Syncy-
tien entstehen und gleichzeitig die cbromatinarmen, normal rundlichen Kerne eckige und
zackig gelappte Formen annehmen. Zwischen sterilen und infizierten Gebieten konnte ich
ebenso oft scharfe Grenzlinien wie fließende Übergänge feststellen, wogegen G. R ic h t e r
die scharfe Trennung beider betont. Die Abbildung 72 b, die ich nach einem ihrer Präp a rate
anfertigte, zeigt den Gegensatz zwischen sterilem und organartig infiziertem syncytia-
len Fettgewebe sehr deutlich. Vermutlich sind in der Jugend (Larven) bei allen Formen
die sterilen Fettlappen deutlich abgetrennt, werden aber später von benachbarten Zonen
aus durch einzelne Hefen besiedelt, so daß sich die klaren Umrisse verwischen. So bietet
sich im allgemeinen das Bild eines noch sehr ungeregelten Befalls und eines verhältnismäßig
lockeren symbiontischen Verhältnisses zwischen Wirtsgewebe und Mikroorganismus,
das nur bei der von R ic h t e r beschriebenen Ormenis-Art schon zu einer organartigen
Isolierung der Symbionten auf bestimmte, aber noch regellos verteilte Fettgewebslap-
pen geführt hat.
Wenn bisher und auch im folgenden in dieser Arbeit für eine bestimmte Symbionten-
sorte der Ausdruck „Hefen“ verwendet wird, so geschieht das im Sinne B u c h n e r ’s nu r m it
Vorbehalt und mehr der Kürze halber und so lange keine Kulturversuche über die wahre
Zugehörigkeit dieser Form exakten Aufschluß ergeben. Es ist jedoch anzunehmen, daß es
sich hier um ähnliche Symbionten wie bei den Schildläusen handelt, die sich in Kulturen
von Sc hw a r z (1924) als Konidien von Ascomyceten erwiesen haben. — Es sind meist recht
große, nur bei Acanalonia chloris kleine, Formen von plump eiförmiger (Ormenis testacea,
Phalaenomorpha corticina, Ityraea speciosa, Flc, Flf), lang elliptischer (Ormenis-
Larven, Acanalonia chloris), meist aber schlank zigarrenförmiger Gestalt und innerhalb
eines Individuums etwas veränderlicher Größe. Bei Ormenis spec., Flf und Acanalonia
virescens trifft man unter normalen Stadien auch vereinzelte von oft mehr als doppelter
Größe (Abb. 72) und mit intensiver färbbarem Plasma, die wohl als Involutionsformen
zu werten sind. Bei allen diesen Hefen ist eine kräftige Zellmembran und ein punktförmiger,
mit Hämalaun tief blauvioletter Kern zu erkennen. Das eosinophile Plasma zeigt
stets hellere Vakuolen in wechselnder Anzahl, so daß neben dichteren, dunkleren stets hellere
und lockerere Formen auftreten. Kleine, stark lichtbrechende Granula, die vereinzelt
oder auch dicht gedrängt das Plasma durchsetzen und oft den ganzen Symbiontenleib erfüllen,
vergrößern außerdem die Zahl der Erscheinungsformen der Hefen, die zweifellos
verschiedenen Alters- und Stoffwechselzuständen entsprechen. Sie finden sich in gleichem
Verhältnis auch unter den in die Eier entsandten Infektionsformen wieder. Im Wirtsplasma
erzeugt jede Hefezelle eine eigene Vakuole, die allerdings sekundär mit Nachbarvakuolen
verfließen kann.
Das unpaare f - O r g a n zieht als langer, sehr dünner Schlauch quer durch den hinteren
Teil des Abdomens, oft mehrfach gewunden und verschlungen und besonders an den
Enden aufgeknäult. In ungestörter Lagerung bei Larven und jugendlichen Imaginas bildet
es eine flach W-förmige Figur (Abb. XIII), die besonders bei den Phalaenomorphiden
sehr ausgeprägt ist. Im Verhältnis zu der Größe des Wirtes ist es ein sehr unscheinbares
Mycetom, mit den entsprechenden Organen anderer Fulgoroiden verglichen aber relativ
kräftig und eindrucksvoll, besonders bei den Flatiden. Wie gewöhnlich umzieht ein kräftiges,
meist flaches, selten (Acanalonia) kubisches Epithel mit entsprechend flachen oder
rundlichen Kernen das Organ. Auch hier liegen die chromatinarmen Kerne vorzugsweise
in den inneren, oft etwas erweiterten Teilen der Epithelzellen. Das Innere des
Mycetoms besteht aus sehr vielen, kleinen, rundlich polygonalen Mycetocyten, die sich
selten noch einreihig (Ormenis testacea), oder zweireihig (Phalaenomorphidae, Abb. 74),
sondern meist in mehrfacher Schicht hintereinander anordnen (Abb. 75). Sie enthalten
zentral einen großen, runden, außerordentlich chromatinreichen Kern und werden von
winzigen, sehr blassen, offenbar kugeligen Symbionten prall ausgefüllt. Die Tracheen sind
hier englumiger und spärlicher vertreten als bei Cixiiden und Derbiden.
Die E i i n f e k t i o n konnte ich nur bei Ormenis testacea näher verfolgen. Lange Zeit
vor dem Eintreffen der Infektionsformen, etwa mit dem Beginn der Ablagerung eosinophiler
Dotterschollen im Ei, werden am unteren Eipol schon Vorbereitungen zum Empfang
der Symbionten getroffen (Abb. 76 a). In der Mitte des flach abgeplatteten Eipols
entsteht im Dotter eine tief napfförmige Grube, die sich mit einem kurzzylindrischen
Spaltraum, der sich zentral in den Keilzellfollikel einsenkt, zu einem sehr charakteristischen,
pilzförmigen Hohlraum verbindet, dessen Inneres von einem grobblasigen, plasmatischen
Netzwerk erfüllt ist. Die fünf bis sechs seitlich angrenzenden Zellschichten des
Follikels verwandeln sich zum Keilzellfollikel, indem sich die einzelnen Zellen extrem
schlauchartig strecken und in eine tangentiale Richtung umzuschwenken beginnen, so daß
sie in einem Winkel von ca. 45° zur Eioberfläche nach dem pilzförmigen Hohlraum hin