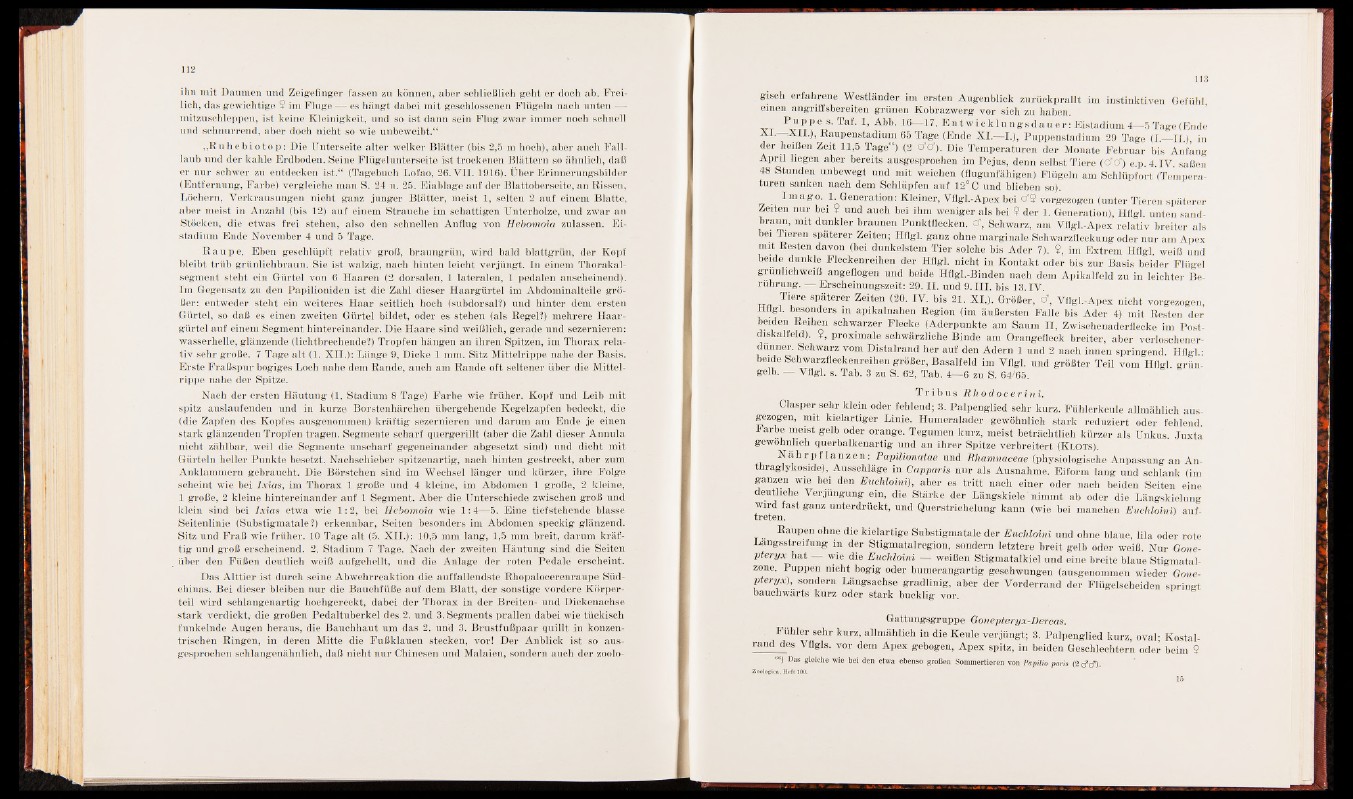
ihn mit Daumen und Zeigefinger fassen zu können, aber schließlich geht er doch ab. Freilich,
das gewichtige 9 im Fluge — es hängt dabei mit geschlossenen Flügeln nach unten - S
mitzuschleppen, ist keine Kleinigkeit, und so ist dann sein Flug zwar immer noch schnell
und schnurrend, aber doch nicht so wie unbeweibt.“
„ R u h e b i o t o p : Die Unterseite alter welker Blätter (bis 2,5 m hoch), aber auch FalL
laub und der kahle Erdboden. Seine Flügelunterseite ist trockenen Blättern so ähnlich, daß
er nur schwer zu entdecken ist.“ (Tagebuch Lofao, 26. VII. 1916). Über Erinnerungsbilder
(Entfernung, Farbe) vergleiche man S. 24 u. 25. Eiablage auf der Blattoberseite, an Rissen,
Löchern, Verkrausungen nicht ganz junger Blätter, meist 1, selten 2 auf einem Blatte,
aber meist in Anzahl (bis 12) auf einem Strauche im schattigen Unterholze, und zwar an
Stöcken, die etwas frei stehen, also den schnellen Anflug von Hebomoia zulassen. Eistadium
Ende November 4 und 5 Tage.
Ra up e . Eben geschlüpft relativ groß, braungrün, wird bald blattgrün, der Kopf
bleibt trüb grünlichbraun. Sie ist walzig, nach hinten leicht verjüngt. In einem Thorakalsegment
steht ein Gürtel von 6 Haaren (2 dorsalen, 1 lateralen, 1 pedalen anscheinend).
Im Gegensatz zu den Papilioniden ist die Zahl dieser Haargürtel im Abdominalteile größer:
entweder steht ein weiteres Haar seitlich hoch (subdorsal?) und hinter dem ersten
Gürtel, so daß es einen zweiten Gürtel bildet, oder es stehen (als Regel?) mehrere Haar-
giirtel auf einem Segment hintereinander. Die Haare sind weißlich, gerade und sezernieren:
wasserhelle, glänzende (lichtbrechende?) Tropfen hängen an ihren Spitzen, im Thorax relativ
sehr große. 7 Tage alt (1. XII.): Länge 9, Dicke 1 mm. Sitz Mittelrippe nahe der Basis.
Erste Fraßspur bogiges Loch nahe dem Rande, auch am Rande oft seltener über die Mittelrippe
nahe der Spitze.
Nach der ersten Häutung (1. Stadium 8 Tage) Farbe wie früher. Kopf und Leib mit
spitz auslaufenden und in kurze Borstenhärchen übergehende Kegelzapfen bedeckt, die
(die Zapfen des Kopfes ausgenommen) kräftig sezernieren und darum am Ende je einen
stark glänzenden Tropfen tragen. Segmente scharf quergerillt (aber die Zahl dieser Annula
nicht zählbar, weil die Segmente unscharf gegeneinander abgesetzt sind) und dicht mit
Gürteln heller Punkte besetzt. Nachschieber spitzenartig, nach hinten gestreckt, aber zum
Anklammern gebraucht. Die Börstchen sind im Wechsel länger und kürzer, ihre Folge
scheint wie bei Ixias, im Thorax 1 große und 4 kleine, im Abdomen 1 große, 2 kleine,
1 große, 2 kleine hintereinander auf 1 Segment. Aber die Unterschiede zwischen groß und
klein sind bei Ixias etwa wie 1:2, bei Hebomoia wie 1:4—5. Eine tief stehende blasse
Seitenlinie (Substigmatale?) erkennbar, Seiten besonders im Abdomen speckig glänzend.
Sitz und Fraß wie früher. 10 Tage a lt (5. XII.): 10,5 mm lang, 1,5 mm breit, darum k rä ftig
und groß erscheinend. 2. Stadium 7 Tage. Nach der zweiten Häutung sind die Seiten
über den Füßen deutlich weiß aufgehellt, und die Anlage der roten Pedale erscheint.
Das Alttier ist durch seine Abwehrreaktion die auffallendste Rhopalocerenraupe Südchinas.
Bei dieser bleiben nur die Bauchfüße auf dem Blatt, der sonstige vordere Körperteil
wird schlangenartig hochgereckt, dabei der Thorax in der Breiten- und Dickenachse
stark verdickt, die großen Pedaltuberkel des 2. und 3. Segments prallen dabei wie tückisch
funkelnde Augen heraus, die Bauchhaut um das 2. und 3. Brustfußpaar quillt in konzentrischen
Ringen, in deren Mitte die Fußklaüen stecken, vor! Der Anblick ist so ausgesprochen
schlangenähnlich, daß nicht nur Chinesen und Malaien, sondern auch der zoologisch
erfahrene Westländer im ersten Augenblick zurückprallt im instinktiven Gefühl,
einen angriffsbereiten grünen Kobrazwerg vor sich zu haben.
P u p p e s. Taf. 1, Abb. 16—17.. E n tw i c k l u n g s d a u e r : Eistadium 4—5 Tage (Ende
, Raupenstadium 65 Tage (Ende XI.—L), Puppenstadium 29 Tage (I.—II.) in
der heißen Zeit 11,5 Tage“ ) (2 B * h . Die Temperaturen der Monate Februar bis Anfang
April liegen aber bereits ausgesprochen im Pejus, denn selbst Tiere (cfc?) e.p. 4. IV. saßen
48 Stunden unbewegt und mit weichen (flugunfähigen) Flügeln am Schlüpfort (Temperaturen
sanken nach dem Schlüpfen auf 12° C und blieben so).
I ma g o . 1. Generation: Kleiner, Vflgl.-Apex bei # | | vorgezogen (unter Tieren späterer
Zeiten nur bei $ Und auch bei ihm weniger als bei » e r 1. Generation), Hflgl. unten sandbraun,
mit dunkler braunen Punktflecken. g |, Schwarz, am Vflgl.-Apex relativ breiter als
bei Tieren späterer Zeiten; Hflgl. ganz ohne marginale Sehwarzfleckung oder nur am Apex
mit Kesten davon (bei dunkelstem Tier solche bis Ader « B i im Extrem Hflgl. weiß und
beide dunkle Fleckenreihen der Hflgl. nicht in Kontakt oder bis zur Basis beider Flügel
grünlichweiß angeflogen und beide Hflgl.-Binden nach dem Apikalfeld zu in leichter Berührung.
M Erscheinungszeit: 29. II. und 9. III. bis 13. IV.
Tiere späterer Zeiten (20. IV. bis 21. XI.). Größer,-3Öy Vflgl.-Apex nicht vorgezogen,
Hflgl. besonders m apikalnahen Region (im äußersten Falle bis Ader 4) mit Kesten der
beiden Reihen schwarze» Flecke (Aderpunkfcf am Saum II, Zwischenaderfleeke im Post-
diskalfeld). ?, proximale schwärzliche Binde am Orangefleck breiter, aber verloschener-
dünner. Schwarz vom Distalrand her auf den Adern 1 und 2 nach innen springend. Hflgl.:
beide Schwarzfleckenreihen größer, Basalfeld im Vflgl. und größter Teil vom Hflgl grüngelb.
S Vflgl. S. Tab. 3 ZU S. 62, Tab. 4—6 zu S. 64/65.
T r i b u s R h o d o c e r i n i .
Clasper sehr klein oder fehlend; 3. Palpenglied sehr kurz. Fühlerkeule allmählich ausgezogen,
mit kielartiger Linie, Humeralader gewöhnlich stark reduziert oder fehlend.
I arbe meist gelb oder orange. Tegumen kurz, meist beträchtlich kürzer als Unkus. Ju x ta
gewöhnlich querbalkenartig und an ihrer Spitze verbreitert (K l o t s ).
N ä h r p f 1 a n z e n : Papilicmatae und Rhamnäceqe (physiologische Anpassung an An-
thraglykoside); Ausschläge in Capparis nu r als Ausnahme. Eiform lang und schlank (im
ganzen wie bei den Euchloini), aber es tritt nach einer oder nach beiden Seiten eine
deutliche Verjüngung ein, die Stärke der Längskiele' nimmt ab oder die Langskielung
Wttd fast ganz unterdrückt, und Querstrichelung kann (wie bei manchen Euchloini) auf-
treten.
Raupen ohne die kielartige Substigmatale der Euchloini und ohne blaue, lila oder rote
Langsstreifung in der Stigmatalregion, sondern letztere breit gelb oder weiß. Nur Gone-
pteryx hat - wie die EuchloiniSB&reißen Stigmatalkiel und eine breite blaue Stigmatal-
zöne. Puppen nicht bogig oder bumerangartig geschwungen (ausgenommen wieder Gone-
pteryx), sondern Längsachse gradlinig, aber der Vorderrand der Flügelscheiden springt
bauchwärts kurz oder stark bucklig vor.
Gattungsgruppe Gonepteryx-Dercas.
Fühler sehr kurz, allmählich in die Keule verjüngt; 3. Palpenglied kurz, oval- Kostal-
rand des Vf,ä'Is- ™r dem Apex gebogen, Apex spitz, in beiden Geschlechtern oder beim S
**) D“ wie bei den etwa ebenso großen Sonamertieren von Papillo paris
Zoologien, Heft 100.