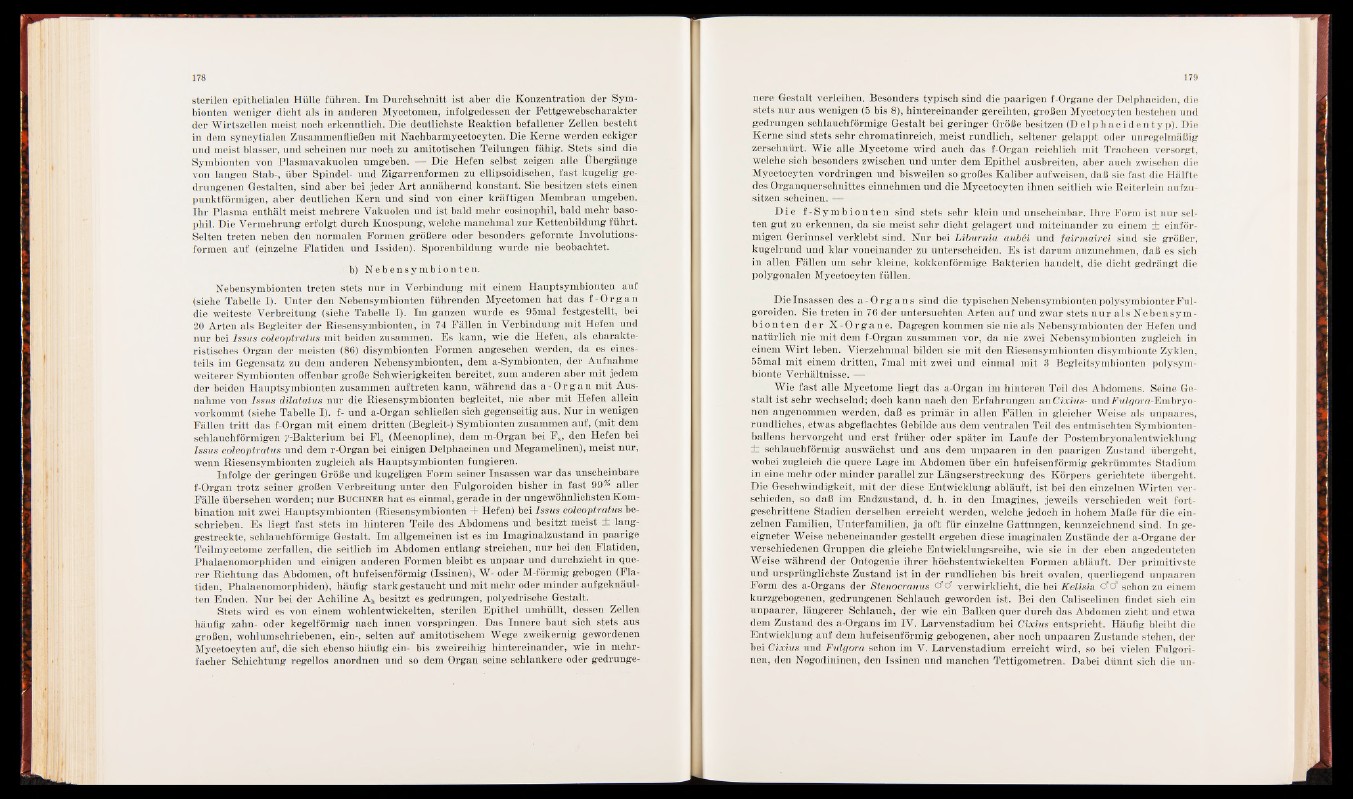
sterilen epithelialen Hülle führen. Im Durchschnitt ist aber die Konzentration der Sym-
bionten weniger dicht als in anderen Mycetomen, infolgedessen der Fettgewehscharakter
der Wirtszellen meist noch erkenntlich. Die deutlichste Reaktion befallener Zellen besteht
in dem syncytialen Zusammenfließen mit Nachbarmycetocyten. Die Kerne werden eckiger
und meist blasser, und scheinen nur noch zu amitotischen Teilungen fähig. Stets sind die
Symbionten von Plasmavakuolen umgeben. — Die Hefen selbst zeigen alle Übergänge
von langen Stab-, über Spindel- und Zigarrenformen zu ellipsoidischen, fast kugelig gedrungenen
Gestalten, sind aber bei jeder Art annähernd konstant. Sie besitzen stets einen
punktförmigen, aber deutlichen Kern und sind von einer kräftigen Membran umgeben.
Ih r Plasma enthält meist mehrere Vakuolen und ist bald mehr eosinophil, bald mehr basophil.
Die Vermehrung erfolgt durch Knospung, welche m anchmal zur Kettenbildung führt.
Selten treten neben den normalen Formen größere oder besonders geformte Involutionsformen
auf (einzelne Flatiden und Issiden). Sporenbildung wurde nie beobachtet.
b) N e b e n s ymb i o n t e n .
Nebensymbionten treten stets n ur in Verbindung mit einem Hauptsymbionten auf
(siebe Tabelle I). Unter den Nebensymbionten führenden Mycetomen hat das f - O r g a n
die weiteste Verbreitung (siehe Tabelle I). Im ganzen wurde es 95mal festgestellt, bei
20 Arten als Begleiter der Riesensymbionten, in 74 Fällen in Verbindung mit Hefen und
nur bei Issus coleoptratus mit beiden zusammen. Es kann, wie die Hefen, als charakteristisches
Organ der meisten (86) disymbionten Formen angesehen werden, da es einesteils
im Gegensatz zu dem anderen Nebensymbionten, dem a-Symbionten, der Aufnahme
weiterer Symbionten offenbar große Schwierigkeiten bereitet, zum anderen aber mit jedem
der beiden Hauptsymbionten zusammen auftreten kann, während das a - 0 r g a n mit Ausnahme
von Issus dilatatus nur die Riesensymbionten begleitet, nie aber mit Hefen allein
vorkommt (siehe Tabelle I). f- und a-Organ schließen sich gegenseitig aus. Nur in wenigen
Fällen tritt das f-Organ mit einem dritten (Begleit-) Symbionten zusammen auf, (mit dem
schlauchförmigen ^-Bakterium bei Fla (Meenopline), dem m-Organ bei F x, den Hefen bei
Issus coleoptratus und dem r-Organ bei einigen Delphacinen und Megamelinen), meist nur,
wenn Riesensymbionten zugleich als Hauptsymbionten fungieren.
Infolge der geringen Größe und kugeligen Form seiner Insassen war das unscheinbare
f-Organ trotz seiner großen Verbreitung unter den Fulgoroiden bisher in fast 99% aller
Fälle übersehen worden; nur B ü c h n e r hat es einmal, gerade in der ungewöhnlichsten Kombination
mit zwei Hauptsymbionten (Riesensymbionten + Hefen) bei Issus coleoptratus beschrieben.
Es liegt fast stets im hinteren Teile des Abdomens und besitzt meist ± langgestreckte,
schlauchförmige Gestalt. Im allgemeinen ist es im Imaginalzustand in paarige
Teilmycetome zerfallen, die seitlich im Abdomen entlang streichen, nur bei den Flatiden,
Phalaenomorphiden und einigen anderen Formen bleibt es unpaar und durchzieht in quere
r Richtung das Abdomen, oft hufeisenförmig (Issinen), W- oder M-förmig gebogen (Flatiden,
Phalaenomorphiden), häufig stark gestaucht und mit mehr oder minder aufgeknäul-
ten Enden. Nur bei der Achiline Ah besitzt es gedrungen, polyedrische Gestalt.
Stets wird es von einem wohlentwickelten, sterilen Epithel umhüllt, dessen Zellen
häufig zahn- oder kegelförmig nach innen vorspringen. Das Innere baut sich stets aus
großen, wohlumschriebenen, ein-, selten auf amitotischem Wege zweikernig gewordenen
Mycetocyten auf, die sich ebenso häufig ein- bis zweireihig hintereinander, wie in mehrfacher
Schichtung regellos anordnen und so dem Organ seine schlankere oder gedrungenere
Gestalt verleihen. Besonders typisch sind die paarigen f-Organe der Delphaciden, die
stets nu r aus wenigen (5 bis 8), hintereinander gereihten, großen Mycetocyten bestehen und
gedrungen schlauchförmige Gestalt bei geringer Größe besitzen ( D e l p h a c i d e n t y p ) . Die
Kerne sind stets sehr ehromatinreich, meist rundlich, seltener gelappt oder unregelmäßig
zerschnürt. Wie alle Mycetome wird auch das f-Organ reichlich mit Tracheen versorgt,
welche sich besonders zwischen und unter dem Epithel ausbreiten, aber auch zwischen die
Mycetocyten Vordringen und bisweilen so großes Kaliber aufweisen, daß sie fast die Hälfte
des Organquerschnittes einnehmen und die Mycetocyten ihnen seitlich wie Reiterlein aufzusitzen
scheinen. —
D ie f - S ymb i o n t e n sind stets sehr klein und unscheinbar. Ihre Form ist nur selten
gut zu erkennen, da sie meist sehr dicht gelagert und miteinander zu einem + einförmigen
Gerinnsel verklebt sind. Nur bei Liburnia aubei und fairmairei sind sie größer,
kugelrund und klar voneinander zu unterscheiden. Es ist darum anzunehmen, daß es sich
in allen Fällen um sehr kleine, kokkenförmige Bakterien handelt, die dicht gedrängt die
polygonalen Mycetocyten füllen.
Die Insassen des a -Or g a n s sind die typischen Nebensymbionten polysymbionter Fulgoroiden.
Sie treten in 76 der untersuchten Arten auf und zwar stets n u r a ls Ne b e n s ymb
i o n t e n d e r X- O r g a n e . Dagegen kommen sie nie als Nebensymbionten der Hefen und
natürlich nie mit dem f-Organ zusammen vor, da nie zwei Nebensymbionten zugleich in
einem Wirt leben. Vierzehnmal bilden sie mit den Riesensymbionten disymbionte Zyklen,
55mal mit einem dritten, 7mal mit zwei und einmal mit 3 Begleitsymbionten polysym-
bionte Verhältnisse.
Wie fast alle Mycetome liegt das a-Organ im hinteren Teil des Abdomens. Seine Gestalt
ist sehr wechselnd; doch kann nach den Erfahrungen a n Cixius- u n dFulgora-ISmbryo-
nen angenommen werden, daß es primär in allen Fällen in gleicher Weise als unpaares,
rundliches, etwas abgeflachtes Gebilde aus dem ventralen Teil des entmischten Symbionten-
ballens hervorgeht und erst früher oder später im Laufe der Postemhryonalentwicklung
=t schlauchförmig auswächst und aus dem unpaaren in den paarigen Zustand übergeht,
wobei zugleich die quere Lage im Abdomen über ein hufeisenförmig gekrümmtes Stadium
in eine m ehr oder minder parallel zur Längserstreckung des Körpers gerichtete übergeht.
Die Geschwindigkeit, mit der diese Entwicklung abläuft, ist bei den einzelnen Wirten verschieden,
so daß im Endzustand, d. h. in den Imagines, jeweils verschieden weit fortgeschrittene
Stadien derselben erreicht werden, welche jedoch in hohem Maße für die einzelnen
Familien, Unterfamilien, ja oft fü r einzelne Gattungen, kennzeichnend sind. In geeigneter
Weise nebeneinander gestellt ergeben diese imaginalen Zustände der a-Organe der
verschiedenen Gruppen die gleiche Entwicklungsreihe, wie sie in der eben angedeuteten
Weise während der Ontogenie ihrer höchstentwickelten Formen abläuft. Der primitivste
und ursprünglichste Zustand ist in der rundlichen bis breit ovalen, querliegend unpaaren
Form des a-Organs der Stenocranus cf G? verwirklicht, die bei Kelisia cf Cf schon zu einem
kurzgebogenen, gedrungenen Schlauch geworden ist. Bei den Caliscelinen findet sich ein
unpaar er, längerer Schlauch, der wie ein Balken quer durch das Abdomen zieht und etwa
dem Zustand des a-Organs im IV. Larvenstadium hei Cixius entspricht. Häufig bleibt die
Entwicklung auf dem hufeisenförmig gebogenen, aber noch unpaaren Zustande stehen, der
bei Cixius und Fulgora schon im V. Larvenstadium erreicht wird, so bei vielen Fulgori-
nen, den Nogodininen, den Issinen und manchen Tettigometren. Dabei dünnt sich die un