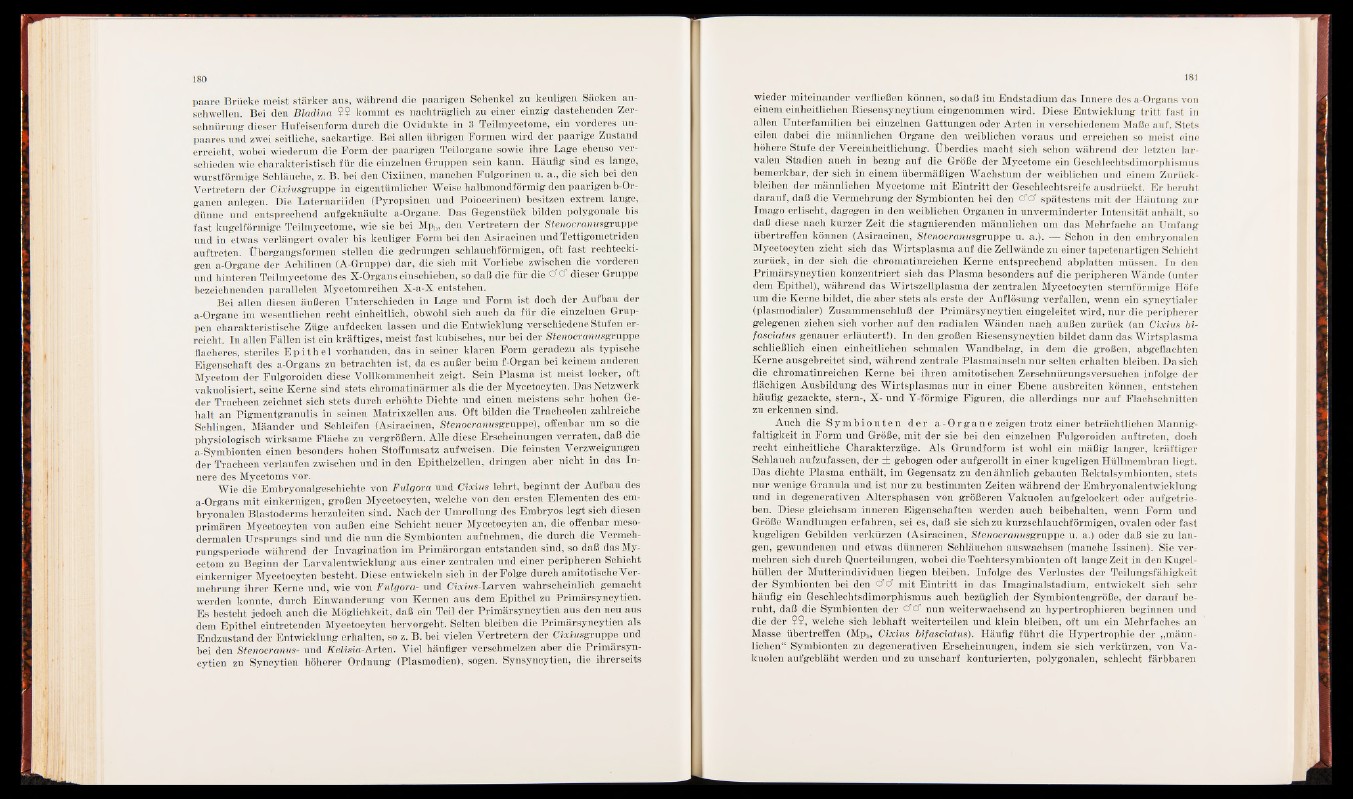
paare Brücke meist stärker aus, während die paarigen Schenkel zu keuligen Säcken anschwellen.
Bei den R ia d iw aB i kommt es nachträglich zu einer einzig dastehenden Zer-
schnürung dieser Hufeisenform durch die Ovidukte in 3 Teilmycetome, ein vorderes un-
paares und zwei seitliche, sackartige. Bei allen übrigen Formen wird der paarige Zustand
erreicht, wobei wiederum die Form der paarigen Teilorgane sowie ihre Lage ebenso verschieden
wie charakteristisch für die einzelnen Gruppen sein kann. Häufig sind es lange,
wurstförmige Schläuche, z. B. bei den Cixiinen, manchen Fulgorinen u. a., die sich hei den
Vertretern der Cixiwsgruppe in eigentümlicher Weise halbmondförmig den paarigen b-Or-
ganen anlegen. Die Laternariiden (Pyropsinen und Poiocerinen) besitzen extrem lange,
dünne und entsprechend aufgeknäulte a-Organe. Das Gegenstück bilden polygonale bis
fast kugelförmige Teilmycetome, wie sie hei Mp,, den Vertretern der £ tenocra//usgru ppe
und in etwas verlängert ovaler bis keuliger Form hei den Asiracinen und Tettigometriden
auftreten. Übergangsformen stellen die gedrungen schlauchförmigen, oft fast rechteckigen
a-Organe der Achilinen (A-Gruppe) dar, die sich mit Vorliebe zwischen die vorderen
und hinteren Teilmycetome des X-Organs einschiehen, so daß die, für die H jjd ie s e r Gruppe
bezeichnenden parallelen Mycetomreihen X-a-X entstehen.
Bei allen diesen äußeren Unterschieden in Lage und Form ist doch der Aufbau der
a-Organe im wesentlichen recht einheitlich, obwohl sieh auch da für die einzelnen Grup^
pen charakteristische Züge aufdecken lassen und die Entwicklung verschiedene Stufen erreicht.
In allen Fällen ist ein kräftiges, meist fast kubisches, nur bei der Sfemocromtsgruppe
flacheres, steriles E p i t h e l vorhanden, das in seiner klaren Form geradezu als typische
Eigenschaft des a-Organs?.zii betrachten ist, da es außer heim f-Organ bei keinem anderen
Mycetom der Fulgoroiden diese Vollkommenheit zeigt. Sein Plasma ist meist locker, oft
vakuolisiert, seine Kerne sind stets chromatinärmer als die der Mycetocyten. Das Netzwerk
der Tracheen zeichnet sich stets durch erhöhte Dichte und einen meistens sehr hohen
halt an Pigmentgranulis in seinen Matrixzellen aus. Oft bilden die Tracheolen zahlreiche
Schlingen, Mäander und Schleifen (Asiracinen, SfeMoeramtsgruppe), offenbar um so die
physiologisch wirksame Fläche zu vergrößern. Alle diese Erscheinungen verraten, daß dig
a-Symhionten einen besonders hohen Stoffümsatz aufweisen. Die feinsten Verzweigungen
der Tracheen verlaufen zwischen und in den Epithelzellen, dringen aber nicht in das In nere
des Mycetoms vor.
Wie die Emhryonalgeschichte von Fulgora und Cixius lehrt, beginnt der Aufbau des
a-Organs mit einkernigen, großen Mycetocyten, welche von den ersten Elementen des embryonalen
Blastoderms herzuleiten sind. Nach der Umrollung des Embryos legt sich diesen
primären Mycetocyten von außen eine Schicht neuer Mycetocyten an, die offenbar mesodermalen
Ursprungs sind und die nun die Symbionten aufnehmen, die durch die Vermehrungsperiode
während der Invagination im Primärorgan entstanden sind, so daß das Mycetom
zu Beginn der Larvalentwicklung aus einer zentralen und einer peripheren Schicht
einkerniger Mycetocyten besteht. Diese entwickeln sich in der Folge durch amitotische Vermehrung
ihrer Kerne und, wie von Fulgora- und Cixius-Larven wahrscheinlich gemacht
werden konnte, durch Einwanderung von Kernen aus dem Epithel zu Primärsyncytien.
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, daß ein Teil der Primärsyncytien aus den neu aus
dem Epithel eintretenden Mycetocyten hervorgeht. Selten bleiben die Primärsyncytien als
Endzustand der Entwicklung erhalten, so z. B. hei vielen Vertretern der Cteinsgruppe und
hei den Stenocranus- und Kelisia-Arten. Viel häufiger verschmelzen aber die Primärsyncytien
zu Syncytien höherer Ordnung (Plasmodien), sogen. Synsyncytien, die ihrerseits
wieder miteinander verfließen können, so daß im Endstadium das Innere des a-Organs von
einem einheitlichen Riesensyncytium eingenommen wird. Diese Entwicklung tritt fast in
allen Unterfamilien hei einzelnen Gattungen oder Arten in verschiedenem Maße auf. Stets
eilen dabei die männlichen Organe den weiblichen voraus und erreichen so meist eine
höhere Stufe der Vereinheitlichung. Überdies macht sich schon während der letzten lar-
valen Stadien aueh in bezug auf die Größe der Mycetome ein Geschlechtsdimorphismus
bemerkbar, der sich in einem übermäßigen Wachstum der weiblichen und einem Zurückbleiben
der männlichen Mycetome mit E in tritt der Geschlechtsreife ausdrückt. E r beruht
darauf , daß die Vermehrung der Symbionten hei den .^teppätestens mit der Häutung zur
Imago erlischt, dagegen in den weiblichen Organen in unverminderter Intensität anhält, so
daß diese nach kurzer Zeit die stagnierenden männlichen um das Mehrfache an Umfang
übertreffen können (Asiracinen, £fe»öcra.»nsgruppe u. a . ) ^ H Schon in den embryonalen
Mycetocyten zieht sich das Wirtsplasma auf die Zellwände zu einer tapetenartigen Schicht
zurück, in der sich die ehromatinreichen Kerne entsprechend abplatten müssen. In den
Primärsyncytien konzentrierts|ich das Plasma besonders auf die peripheren W ände (unter
dem Epithel), während das Wirtszellplasma der zentralen Mycetocyten sternförmige Höfe
um die Kerne bildet, die aber stets als erste der Auflösung verfallen, wenn ein syncytialer
(plasmodialer) Zusammenschluß der Primärsyncytien eingeleitet wird, nur die peripherer
gelegenen ziehen sich Vorher auf den radialen Wänden nach außen zurück (an Cixius bi-
fasciatus genauer erläutert!). In den großen Riesensyncytien bildet dann das Wirtsplasma
Schließlich einen einheitlichen schmalen Wandbelag, in dem die großen, abgeflachten
Kerne ausgebreitet sind, während zentrale Plasmainseln n ur selten erhalten bleiben. Da sich
die ehromatinreichen Kerne bei ihren amitotischen Zerschnürungsversuchen infolge der
flächigen Ausbildung des Wirtsplasmas nur in einer Ebene ausbreiten können, entstehen
häufig gezackte, stern-, X- und Y-förmige Figuren, die allerdings nur auf Flachschnitten
zu erkennen sind.
Auch die S ymb i o n t e n d e r ä -Or g a n e zeigen trotz einer beträchtlichen Mannigfaltigkeit
in Form und Größe, mit der sie bei den einzelnen Fulgoroiden auftreten, doch
recht einheitliche Charakterzüge. Als Grundform ist wohl ein mäßig langer, kräftiger
Schlauch aufzufassen, d e r lf gebogen oder aufgerollt in einer kugeligen Hüllmembran liegt.
Das dichte Plasma enthält, im Gegensatz zu den ähnlich gebauten Rektalsymbionten, stets
nur wenige Granula und ist nur zu bestimmten Zeiten während der Embryonalentwicklung
und in degenerativen Altersphasen von größeren Vakuolen aufgelockert oder aufgetrieben.
Diese gleichsam inneren Eigenschaften werden auch heibehalten, wenn Form und
Größe Wandlungen erfahren, sei es, daß sie sich zu kurzschlauchförmigen, ovalen oder fast
kugeligen Gebilden verkürzen (Asiracinen, Stenocranusgrwppe u. a.) oder daß sie zu langen,
gewundenen und etwas dünneren Schläuchen auswachsen (manche Issinen). Sie vermehren
sich durch Querteilungen, wobei die Toehtersymhionten oft lange Zeit in den Kugelhüllen
der Mutterindividuen liegen hfeiben. Infolge des Verlustes der Teilungsfähigkeit
der Symbionten bei den mit E in tritt in das Imaginalstadium, entwickelt sieh sehr
häufig ein Geschlechtsdimorphismus auch bezüglich der Symbiontengröße, der darauf beruht,
daß die Symbionten der WSBBi nun weiterwachsend zu hypertrophieren beginnen und
die der ®i, welche sich lebhaft weiterteilen und klein bleiben, oft um ein Mehrfaches an
Masse übertreffen (Mpb, Cixius bifasciatus). Häufig führt die Hypertrophie der „männlichen“
Symbionten zu degenerativen Erscheinungen, indem sie sieh verkürzen, von Vakuolen
aufgebläht werden und zu unscharf konturierten, polygonalen, schlecht färbbaren