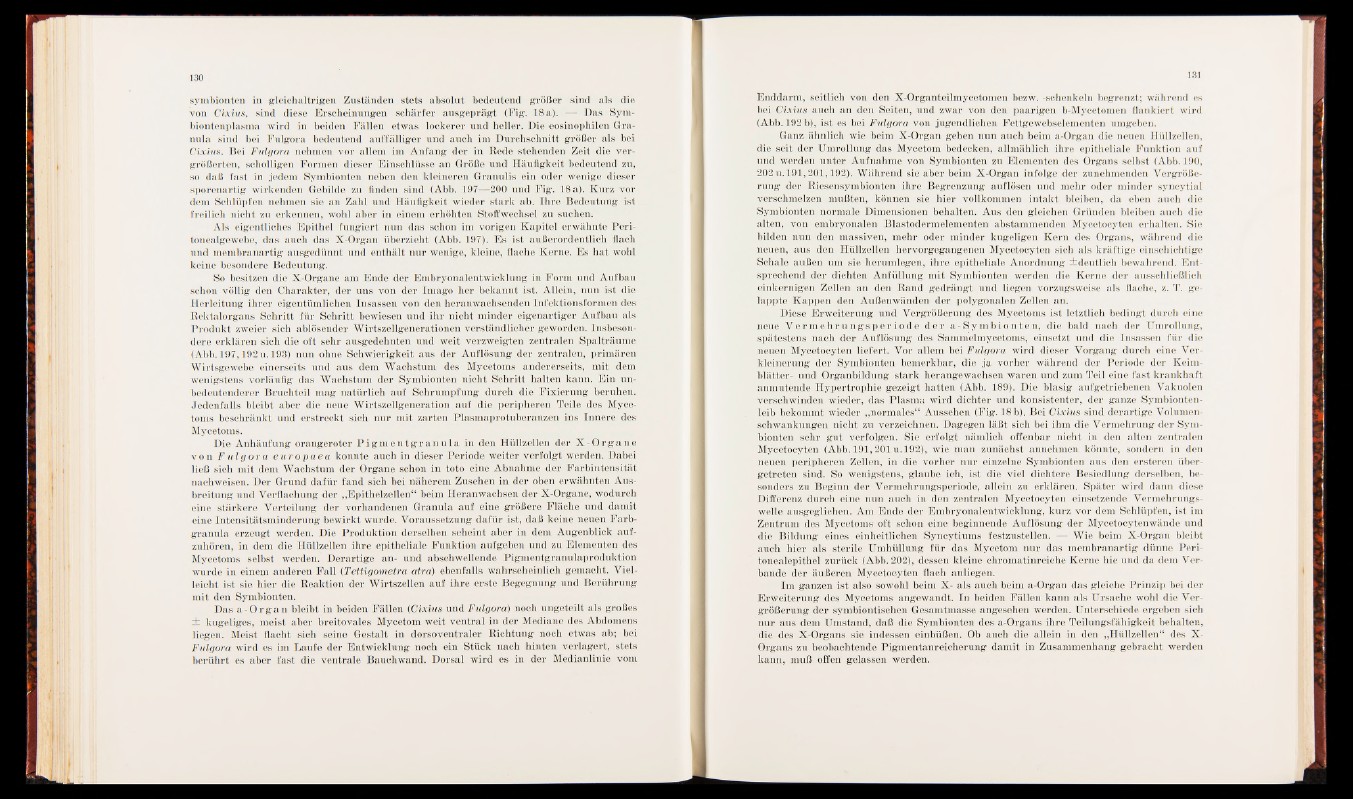
symbionten in gleichaltrigen Zuständen stets absolut bedeutend größer sind als die
von Cixius, sind diese Erscheinungen schärfer ausgeprägt (Fig. 18 a). — Das Sym-
biontenplasma wird in beiden Fällen etwas lockerer und heller. Die eosinophilen Granula
sind bei Fulgora bedeutend auffälliger und auch im Durchschnitt größer als bei
Cixius. Bei Fulgora nehmen vor allem im Anfang der in Rede stehenden Zeit die vergrößerten,
scholligen Formen dieser Einschlüsse an Größe und Häufigkeit bedeutend zu,
so daß fast in jedem Symbionten neben den kleineren Granulis ein oder wenige dieser
sporenartig wirkenden Gebilde zu finden sind (Abb. 197—200 und Fig. 18 a). Kurz vor
dem Schlüpfen nehmen sie an Zahl und Häufigkeit wieder stark ab. Ihre Bedeutung ist
freilich nicht zu erkennen, wohl aber in einem erhöhten Stoffwechsel zu suchen.
Als eigentliches Epithel fungiert nun das schon im vorigen Kapitel erwähnte Peritonealgewebe,
das auch das X-Organ überzieht (Abb. 197). Es ist außerordentlich flach
und membranartig ausgedünnt und enthält nur wenige, kleine, flache Kerne. Es hat wohl
keine besondere Bedeutung.
So besitzen die X-Organe am Ende der Embryonalentwicklung in Form und Aufbau
schon völlig den Charakter, der uns von der Imago her bekannt ist. Allein, nun ist die
Herleitung ihrer eigentümlichen Insassen von den heranwachsenden Infektionsformen des
Rektalorgans Schritt für Schritt bewiesen und ihr nicht minder eigenartiger Aufbau als
Produkt zweier sich ablösender Wirtszellgenerationen verständlicher geworden. Insbesondere
erklären sich die oft sehr ausgedehnten und weit verzweigten zentralen Spalträume
(Abb. 197,192 u. 193) nun ohne Schwierigkeit aus der Auflösung der zentralen, primären
Wirtsgewebe einerseits und aus dem Wachstum des Mycetoms andererseits, mit dem
wenigstens vorläufig das Wachstum der Symbionten nicht Schritt halten kann. Ein unbedeutenderer
Bruchteil mag natürlich auf Schrumpfung durch die Fixierung beruhen.
Jedenfalls bleibt aber die neue Wirtszellgeneration auf die peripheren Teile des Mycetoms
beschränkt und erstreckt sich nur mit zarten Plasmaprotuberanzen ins Innere des
Mycetoms.
Die Anhäufung orangeroter P i g m e n t g r a n u l a in den Hüllzellen der X-O r g a n e
von F u lg o r a e u r o p a e a konnte auch in dieser Periode weiter verfolgt werden. Dabei
ließ sich mit dem Wachstum der Organe schon in toto eine Abnahme der Farbintensität
nach weisen. Der Grund dafür fand sich bei näherem Zusehen in der oben erwähnten Ausbreitung
und Verflachung der „Epithelzellen“ beim Heranwachsen der X-Organe, wodurch
eine stärkere Verteilung der vorhandenen Granula auf eine größere Fläche und damit
eine Intensitätsminderung bewirkt wurde. Voraussetzung dafür ist, daß keine neuen Farb-
granula erzeugt werden. Die Produktion derselben scheint aber in dem Augenblick aufzuhören,
in dem die Hüllzellen ihre epitheliale Funktion aufgeben und zu Elementen des
Mycetoms selbst werden. Derartige an- und abschwellende Pigmentgranulaproduktion
wurde in einem anderen Fall (T ettigometra atra) ebenfalls wahrscheinlich gemacht. Vielleicht
ist sie hier die Reaktion der Wirtszellen auf ihre erste Begegnung und Berührung
mit den Symbionten.
Das a - 0 r g a n bleibt in beiden Fällen (Cixius und Fulgora) noch ungeteilt als großes
i kugeliges, meist aber breitovales Mycetom weit ventral in der Mediane des Abdomens
liegen. Meist flacht sich seine Gestalt in dorsoventraler Richtung noch etwas ab; bèi
Fulgora wird es im Laufe der Entwicklung noch ein Stück nach hinten verlagert, stets
berührt es aber fast die ventrale Bauchwand. Dorsal wird es in der Medianlinie vom
Enddarm, seitlich von den X-Organteilmycetomen bezw. -Schenkeln begrenzt; während es
bei Cixius auch an den Seiten, und zwar von den paarigen b-Mycetomen flankiert wird
(Abb. 192 b), ist es bei Fulgora von jugendlichen Fettgewebselementen umgeben.
Ganz ähnlich wie beim X-Organ geben nun auch beim a-Organ die neuen Hüllzellen,
die seit der Umrollung das Mycetom bedecken, allmählich ihre epitheliale Funktion auf
und werden unter Aufnahme von Symbionten zu Elementen des Organs selbst (Abb. 190,
202 u. 191,201,192). Während sie aber beim X-Organ infolge der zunehmenden Vergrößerung
der Riesensymbionten ihre Begrenzung auflösen und mehr oder minder syncytial
verschmelzen mußten, können sie hier vollkommen intakt bleiben, da eben auch die
Symbionten normale Dimensionen behalten. Aus den gleichen Gründen bleiben auch die
alten, von embryonalen Blastodermelementen abstammenden Mycetocyten erhalten. Sie
bilden nun den massiven, mehr oder minder kugeligen Kern des Organs, während die
neuen, aus den Hüllzellen hervorgegangenen Mycetocyten sich als kräftige einschichtige
Schale außen um sie herumlegen, ihre epitheliale Anordnung ¿deutlich bewahrend. E ntsprechend
der dichten Anfüllung mit Symbionten werden die Kerne der ausschließlich
einkernigen Zellen an den Rand gedrängt und liegen vorzugsweise als flache, z. T. gelappte
Kappen den Außenwänden der polygonalen Zellen an.
Diese Erweiterung und Vergrößerung des Mycetoms ist letztlich bedingt durch eine
neue V e rm e h r u n g s p e r i o d e d e r a - S ym b i o n t e n , die bald nach der Umrollung,
spätestens nach der Auflösung des Sammelmycetoms, einsetzt und die Insassen für die
neuen Mycetocyten liefert. Vor allem bei Fulgora wird dieser Vorgang durch eine Verkleinerung
der Symbionten bemerkbar, die ja vorher während der Periode der Keimblätter
und Organbildung stark herangewachsen waren und zum Teil eine fast krankhaft
anmutende Hypertrophie gezeigt hatten (Abb. 189). Die blasig auf getriebenen Vakuolen
verschwinden wieder, das Plasma wird dichter und konsistenter, der ganze Symbionten-
leib bekommt wieder „normales“ Aussehen (Fig. 18 b). Bei Cixius sind derartige Volumenschwankungen
nicht zu verzeichnen. Dagegen läßt sich bei ihm die Vermehrung der Symbionten
sehr gut verfolgen. Sie erfolgt nämlich offenbar nicht in den alten zentralen
Mycetocyten (Abb. 191,201 u. 192), wie man zunächst annehmen könnte, sondern in den
neuen peripheren Zellen, in die vorher nur einzelne Symbionten aus den ersteren übergetreten
sind. So wenigstens, glaube ich, ist die viel dichtere Besiedlung derselben, besonders
zu Beginn der Vermehrungsperiode, allein zu erklären. Später wird dann diese
Differenz durch eine nun auch in den zentralen Mycetocyten einsetzende Vermehrungswelle
ausgeglichen. Am Ende der Embryonalentwicklung, kurz vor dem Schlüpfen, ist im
Zentrum des Mycetoms oft schon eine beginnende Auflösung der Mycetocytenwände und
die Bildung eines einheitlichen Syncytiums festzustellen. M Wie beim X-Organ bleibt
auch hier als sterile Umhüllung für das Mycetom nur das membranartig dünne Pe ritonealepithel
zurück (Abb. 202), dessen kleine chromatinreiche Kerne hie und da dem Verbände
der äußeren Mycetocyten flach anliegen.
Im ganzen ist also sowohl beim X- als auch beim a-Organ das gleiche Prinzip bei der
Erweiterung des Mycetoms angewandt. In beiden Fällen kann als Ursache wohl die Vergrößerung
der symbiontischen Gesamtmasse angesehen werden. Unterschiede ergeben sich
nur aus dem Umstand, daß die Symbionten des a-Organs ihre Teilungsfähigkeit behalten,
die des X-Organs sie indessen einbüßen. Ob auch die allein in den „Hüllzellen“ des X-
Organs zu beobachtende Pigmentanreicherung damit in Zusammenhang gebracht werden
kann, muß offen gelassen werden.