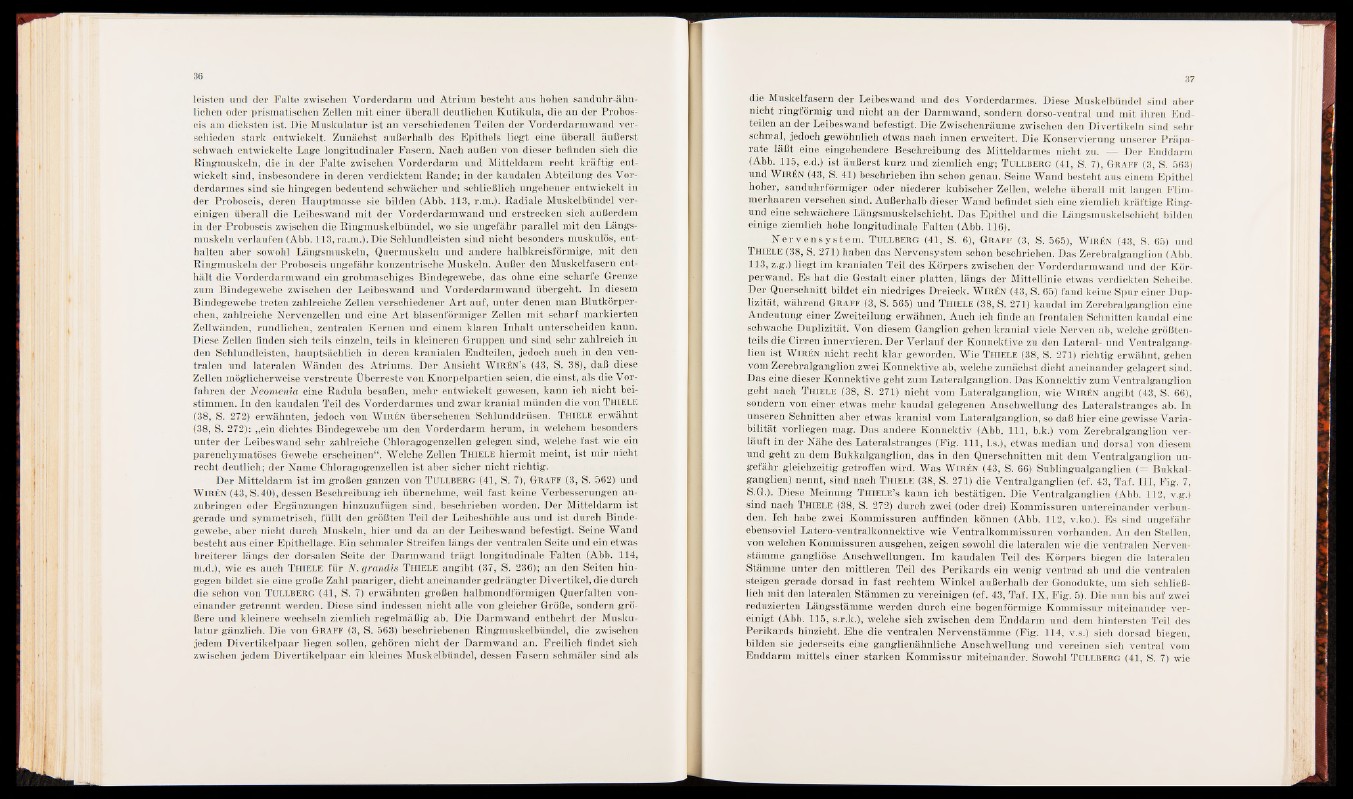
leisten und der Falte zwischen Vorderdarm und Atrium besteht aus hohen sanduhr-ähnlichen
oder prismatischen Zellen mit einer überall deutlichen Kutikula, die an der Probos-
cis am dicksten ist. Die Muskulatur ist an verschiedenen Teilen der Vorderdarmwand verschieden
stark entwickelt. Zunächst außerhalb des Epithels liegt eine überall äußerst
schwach entwickelte Lage longitudinaler Fasern. Nach außen von dieser befinden sich die
Ringmuskeln, die in der Falte zwischen Vorderdarm und Mitteldarm recht kräftig entwickelt
sind, insbesondere in deren verdicktem Rande; in der kaudalen Abteilung des Vorderdarmes
sind sie hingegen bedeutend schwächer und schließlich ungeheuer entwickelt in
der Proboscis, deren Hauptmasse sie bilden (Abb. 113, r.m.). Radiale Muskelbündel vereinigen
überall die Leibeswand mit der Vorderdarmwand und erstrecken sich außerdem
in der Proboscis zwischen die Ringmuskelbündel, wo sie ungefähr parallel mit den Längsmuskeln
verlaufen (Abb. 113, ra.m.). Die Schlundleisten sind nicht besonders muskulös, enthalten
aber sowohl Längsmuskeln, Quermuskeln und andere halbkreisförmige, mit den
Ringmuskeln der Proboscis ungefähr konzentrische Muskeln. Außer den Muskelfasern enthält
die Vorderdarmwand ein grobmaschiges Bindegewebe, das ohne eine scharfe Grenze
zum Bindegewebe zwischen der Leibeswand und Vor der darm wand übergeht. In diesem
Bindegewebe treten zahlreiche Zellen verschiedener A rt auf, unter denen man Blutkörperchen,
zahlreiche Nervenzellen und eine A rt blasenförmiger Zellen mit scharf markierten
Zellwänden, rundlichen, zentralen Kernen und einem klaren Inhalt unterscheiden kann.
Diese Zellen finden sich teils einzeln, teils in kleineren Gruppen und sind sehr zahlreich in
den Schlundleisten, hauptsächlich in deren kranialen Endteilen, jedoch auch in den ventralen
und lateralen Wänden des Atriums. Der Ansicht WiREN’s (43, S. 38), daß diese
Zellen möglicherweise verstreute Überreste von Knorpelpartien seien, die einst, als die Vorfahren
der Neomenia eine Radula besaßen, mehr entwickelt gewesen, kann ich nicht beistimmen.
In den kaudalen Teil des Vorderdarmes und zwar k ranial münden die von T h i e l e
(38, S. 272;) erwähnten, jedoch von W i r e n übersehenen Schlunddrüsen. T h i e l e erwähnt
(38, S. 272): „ein dichtes Bindegewebe um den Vorderdarm herum, in welchem besonders
unter der Leibeswand sehr zahlreiche Chloragogenzellen gelegen sind, welche fast wie ein
parenchymatöses Gewebe erscheinen“. Welche Zellen T h i e l e hiermit meint, ist mir nicht
recht deutlich; der Name Chloragogenzellen ist aber sicher nicht richtig.
Der Mitteldarm ist im großen ganzen von T u l l b e r g (41, S. 7), G r a f f (3, S. 562) und
W i r e n (43, S. 40), dessen Beschreibung ich übernehme, weil fast keine Verbesserungen anzubringen
oder Ergänzungen hinzuzufügen sind, beschrieben worden. Der Mitteldarm ist
gerade und symmetrisch, füllt den größten Teil der Leibeshöhle aus und ist durch Bindegewebe,
aber nicht durch Muskeln, hier und da an der Leibeswand befestigt. Seine Wand
besteht aus einer Epithellage. Ein schmaler Streifen längs der ventralen Seite und ein etwas
breiterer längs der dorsalen Seite der Darmwand träg t longitudinale Falten (Abb. 114,
m.d.), wie es auch T h i e l e für N. grandis T h i e l e angibt (37, S. 236); an den Seiten hingegen
bildet sie eine große Zahl paariger, dicht aneinander gedrängter Divertikel, die durch
die schon von T u l l b e r g (41, S. 7) erwähnten großen halbmondförmigen Querfalten voneinander
getrennt werden. Diese sind indessen nicht alle von gleicher Größe, sondern größere
und kleinere wechseln ziemlich regelmäßig ab. Die Darmwand entbehrt der Muskulatur
gänzlich. Die von G r a f f (3, S. 563) beschriebenen Ringmuskelbündel, die zwischen
jedem Divertikelpaar liegen sollen, gehören nicht der Darmwand an. Freilich findet sich
zwischen jedem Divertikelpaar ein kleines Muskelbündel, dessen Fasern schmäler sind als
die Muskelfasern der Leibeswand und des Vorderdarmes. Diese Muskelbündel sind aber
nicht ringförmig und nicht an der Darmwand, sondern dorso-ventral und mit ihren Endteilen
an der Leibeswand befestigt. Die Zwischenräume zwischen den Divertikeln sind sehr
schmal, jedoch gewöhnlich etwas nach innen erweitert. Die Konservierung unserer Präp a rate
läßt eine eingehendere Beschreibung des Mitteldarmes nicht zu. — Der Enddarm
(Abb. 115, e.d.) ist äußerst kurz und ziemlich eng; T u l l b e r g (41, S. 7), G r a f f (3, S. 563)
und W i r e n (43, S. 41) beschrieben ihn schon genau. Seine Wand besteht aus einem Epithel
hoher, sanduhrförmiger oder niederer kubischer Zellen, welche überall mit langen Flimmerhaaren
versehen sind. Außerhalb dieser Wand befindet sich ei ne ziemlich kräftige Ring-
und eine schwächere Längsmuskelschicht. Das Epithel und die Längsmuskelschicht bilden
einige ziemlich hohe longitudinale Palten (Abb. 116).,:
N e r v e n s y s t em . T u l l b e r g (41, S. 6), G r a f f (3, S. 565), W i r ö j (43, S. 65) und
T h i e l e (38, S. 2 7 ||h a b e n das Nervensystem schon beschrieben. Das Zerebralganglion (Abb.
liegt im kranialen Teil ¿ «K ö rp e r s zwischen der Vorderdarmwand und der Körperwand.
Es hat die Gestalt einer platten, längs der Mittellinie etwas verdickten Scheibe.
Der Querschnitt bildet ein niedriges Dreieck. WIREN (43, S. 65) fand keine Spur einer Duplizität,
während G r a f f (3, S. 565) und T h i e l e (38, S. 271) kaudal im Zerebralganglion eine
Andeutung einer Zweiteilung erwähnen. Auch ich finde an frontalen Schnitten kaudal eine
schwache Duplizität. Von diesem Ganglion gehen kranial viele Nerven ab, welche größtenteils
die Girren innervieren. Der Verlauf der Konnektive zu den Lateral- und Ventralganglien,
ist W ikL n nicht recht klar geworden. Wie T h i e l e (38, S. 271) richtig erwähnt, gehen
vom Zerebralganglion zwei Konnektive ab, welche zunächst dicht aneinander gelagert sind.
Das eine dieser Konnektive geht zum Lateralganglion. Das Konnektiv zum Ventralganglion
geht nach T h i e l e (38, S. 271) nicht vom Lateralganglion, wie W i r e n angibt (43, S. 66),
sondern von einer etwas mehr kaudal gelegenen Anschwellung des Lateralstranges ab. In
unseren Schnitten aber etwas kranial vom Lateralganglion, so daß hier eine gewisse Variabilität,
vorliegen mag. Das andere Konnektiv (Abb. 111* b.k.'s); vom Zerebralganglion verläuft
in dCr Nähe deS Lateralstranges (Fig. 111, l.s.), etwas median und dorsal von diesem
und geht zu dem Bukkalganglion, das in den Querschnitten mit dem Ventralganglion ungefähr
gleichzeitig getroffen wird. Was W lR iN (13, S. 66) Sublingualganglien (= Bukkalganglien)
nennt, sind nach T h i e l e (38, S. 271) die Ventralganglien (cf. 43, Taf. III, Fig. 7,
S.G.). Diese Meinung T i i i e l e ’s kann ich bestätigen. Die Ventralganglien (Abb. 112, v.g.)
sind nach T h i e l e (38, S. 272) durch zwei (oder drei) Kommissuren untereinander verbunden.
Ich habe zwei Kommissuren auffinden können (Abb. 112, v.ko.). Es sind ungefähr
ebensoviel Laterö-ventralkönnektive wie Ventralkommissuren vorhanden. An den Stellen,
von welchen Kommissuren ausgehen, zeigen sowohl die lateralen wie die ventralen Nerven-
stämme gangliöse Anschwellungen. Im kaudalen Teil des Körpers biegen die lateralen
Stämme unter den mittleren Teil des Perikards ein wenig ventrad ab und die ventralen
steigen gerade dorsad in fast rechtem Winkel außerhalb der Gonodukte, um sich schließlich
mit den lateralen Stämmen zu vereinigen (cf. 43, Taf. IX, Fig. 5). Die nun bis auf zwei
reduzierten Längsstämme werden durch eine bogenförmige Kommissur miteinander vereinigt
(Abb. 115, s.r.k.), welche sich zwischen dem Enddarm und dem hintersten Teil des
Perikards hinzieht. Ehe die ventralen Nervenstämme (Fig. 114, v.s.) sieh dorsad biegen,
bilden sie jederseits eine ganglienähnliche Anschwellung und vereinen sich ventral vom
Enddarm mittels einer starken Kommissur miteinander. Sowohl TULLBERG (41, S. 7) wie