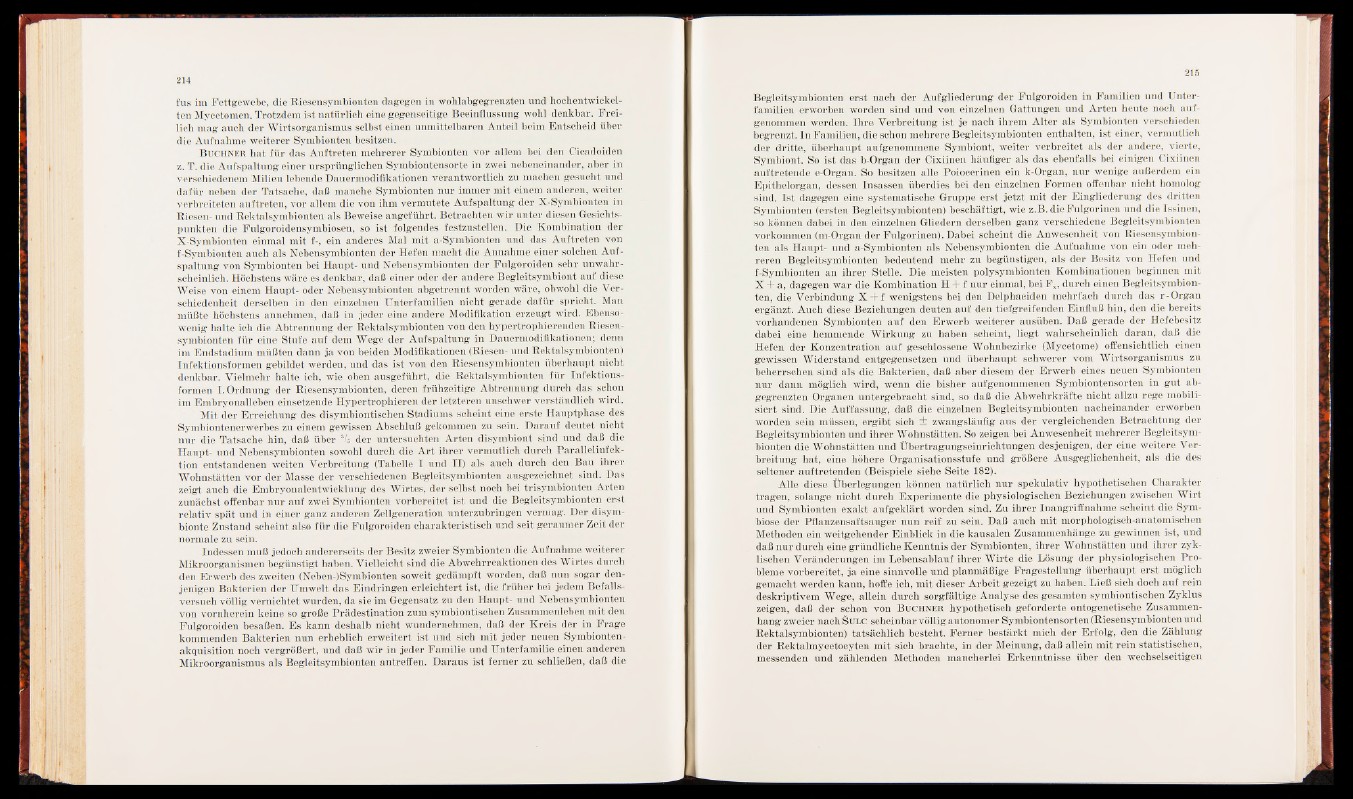
fus im Fettgewebe, die Riesensymbionten dagegen in wohlabgegrenzten und hochentwickelten
Mycetomen. Trotzdem ist natürlich eine gegenseitige Beeinflussung wohl denkbar. Freilich
mag auch der Wirtsorganismus selbst einen unmittelbaren Anteil beim Entscheid über
die Aufnahme weiterer Symbionten besitzen.
B ü c h n e r hat fü r das Auftreten mehrerer Symbionten vor allem bei den Cicadoiden
z. T. die Aufspaltung einer ursprünglichen Symbiontensorte in zwei nebeneinander, aber in
verschiedenem Milieu lebende Dauermodifikationen verantwortlich zu machen gesucht und
dafür neben der Tatsache, daß manche Symbionten nur immer mit einem anderen, weiter
verbreiteten auftreten, vor allem die von ihm vermutete Aufspaltung der X-Symbionten in
Riesen- und Rektalsymbionten als Beweise angeführt. Betrachten wir unter diesen Gesichtspunkten
die Fulgoroidensymbiosen, so ist folgendes festzustellen. Die Kombination der
X-Symbionten einmal mit f-, ein anderes Mal mit a-Symbionten und das Auftreten von
f-Symbionten auch als Nebensymbionten der Hefen macht die Annahme einer solchen Aufspaltung
von Symbionten bei Haupt- und Nebensymbionten der Fulgoroiden sehr unwahrscheinlich.
Höchstens wäre es denkbar, daß einer oder der andere Begleitsymbiont auf diese
Weise von einem Haupt- oder Nebensymbionten abgetrennt worden wäre, obwohl die Verschiedenheit
derselben in den einzelnen Unterfamilien nicht gerade dafür spricht. Man
müßte höchstens annehmen, daß in jeder eine andere Modifikation erzeugt wird. Ebensowenig
halte ich die Abtrennung der Rektalsymbionten von den hypertrophierenden Riesensymbionten
für eine Stufe auf dem Wege der Aufspaltung in Dauermodifikationen; denn
im Endstadium müßten dann ja von beiden Modifikationen (Riesen- und Rektalsymbionten)
Infektionsformen gebildet werden, und das ist von den Riesensymbionten überhaupt nicht
denkbar. Vielmehr halte ich, wie oben ausgeführt, die Rektalsymbionten für Infektionsformen
I. Ordnung der Riesensymbionten, deren frühzeitige Abtrennung durch das schon
im Embryonalleben einsetzende Hypertrophieren der letzteren unschwer verständlich wird.
Mit der Erreichung des disymbiontischen Stadiums scheint eine erste Hauptphase des
Symbiontenerwerbes zu einem gewissen Abschluß gekommen zu sein. Darauf deutet nicht
nur die Tatsache hin, daß über SU der untersuchten Arten disymbiont sind und daß die
Haupt- und Nebensymbionten sowohl durch die Art ihrer vermutlich durch Parallelinfektion
entstandenen weiten Verbreitung (Tabelle I und II) als auch durch den Bau ihrer
Wohnstätten vor der Masse der verschiedenen Begleitsymbionten ausgezeichnet sind. Das
zeigt auch die Embryonalentwicklung des Wirtes, der selbst noch bei trisymbionten Arten
zunächst offenbar nur auf zwei Symbionten vorbereitet ist und die Begleitsymbionten erst
relativ spät und in einer ganz anderen Zellgeneration unterzubringen vermag. Der disym-
bionte Zustand scheint also für die Fulgoroiden charakteristisch und seit geraumer Zeit der
normale zu sein.
Indessen muß jedoch andererseits der Besitz zweier Symbionten die Aufnahme weiterer
Mikroorganismen begünstigt haben. Vielleicht sind die Abwehrreaktionen des Wirtes durch
den Erwerb des zweiten (Neben-)Symbionten soweit gedämpft worden, daß nun sogar denjenigen
Bakterien der Umwelt das Eindringen erleichtert ist, die früher bei jedem Befallsversuch
völlig vernichtet wurden, da sie im Gegensatz zu den Haupt- und Nebensymbionten
von vornherein keine so große Prädestination zum symbiontischen Zusammenleben mit den
Fulgoroiden besaßen. Es kann deshalb nicht wundernehmen, daß der Kreis der in Frage
kommenden Bakterien nun erheblich erweitert ist und sich mit jeder neuen Symbionten-
akquisition noch vergrößert, und daß wir in jeder Familie und Unterfamilie einen anderen
Mikroorganismus als Begleitsymbionten antreffen. Daraus ist ferner zu schließen, daß die
Begleitsymbionten erst nach der Aufgliederung der Fulgoroiden in Familien und Unterfamilien
erworben worden sind und von einzelnen Gattungen und Arten heute noch aufgenommen
werden. Ihre Verbreitung ist je nach ihrem Alter als Symbionten verschieden
begrenzt. In Familien, die schon mehrere Begleitsymbionten enthalten, ist einer, vermutlich
der dritte, überhaupt aufgenommene Symbiont, weiter verbreitet als der andere, vierte,
Symbiont. So ist das b-Organ der Cixiinen häufiger als das ebenfalls bei einigen Cixiinen
auftretende e-Organ. So besitzen alle Poiocerinen ein k-Organ, nur wenige außerdem ein
Epithelorgan, dessen Insassen überdies bei den einzelnen Formen offenbar nicht homolog
sind. Ist dagegen eine systematische Gruppe erst jetzt mit der Eingliederung des dritten
Symbionten (ersten Begleitsymbionten) beschäftigt, wie z.B. die Fulgorinen und die Issinen,
so können dabei in den einzelnen Gliedern derselben ganz verschiedene Begleitsymbionten
Vorkommen (m-Organ der Fulgorinen). Dabei scheint die Anwesenheit von Riesensymbionten
als Haupt- und a-Symbionten als Nebensymbionten die Aufnahme von ein oder mehreren
Begleitsymbionten bedeutend mehr zu begünstigen, als der Besitz von Hefen und
f-Symbionten an ihrer Stelle. Die meisten polysymbionten Kombinationen beginnen mit
X + a, dagegen war die Kombination H + f nur einmal, bei F x, durch einen Begleitsymbionten,
die Verbindung X + f wenigstens bei den Delphaciden mehrfach durch das r-Organ
ergänzt. Auch diese Beziehungen deuten auf den tiefgreifenden Einfluß hin, den die bereits
vorhandenen Symbionten auf den Erwerb weiterer ausüben. Daß gerade der Hefebesitz
dabei eine hemmende Wirkung zu haben scheint, liegt wahrscheinlich daran, daß die
Hefen der Konzentration auf geschlossene Wohnbezirke (Mycetome) offensichtlich einen
gewissen Widerstand entgegensetzen und überhaupt schwerer vom Wirtsorganismus zu
beherrschen sind als die Bakterien, daß aber diesem der Erwerb eines neuen Symbionten
nur dann möglich wird, wenn die bisher aufgenommenen Symbiontensorten in gut abgegrenzten
Organen untergebracht sind, so daß die Abwehrkräfte nicht allzu rege mobilisiert
sind. Die Auffassung, daß die einzelnen Begleitsymbionten nacheinander erworben
worden sein müssen, ergibt sich ± zwangsläufig aus der vergleichenden Betrachtung der
Begleitsymbionten und ihrer Wohnstätten. So zeigen bei Anwesenheit m ehrerer Begleitsymbionten
die Wohnstätten und Übertragungseinrichtungen desjenigen, der eine weitere Verbreitung
hat, eine höhere Organisationsstufe und größere Ausgeglichenheit, als die des
seltener auf tretenden (Beispiele siehe Seite 182).
Alle diese Überlegungen können natürlich nur spekulativ hypothetischen Charakter
tragen, solange nicht durch Experimente die physiologischen Beziehungen zwischen Wirt
und Symbionten exakt aufgeklärt worden sind. Zu ihrer Inangriffnahme scheint die Symbiose
der Pflanzensaftsauger nun reif zu sein. Daß auch mit morphologisch-anatomischen
Methoden ein weitgehender Einblick in die kausalen Zusammenhänge zu gewinnen ist, und
daß nur durch eine gründliche Kenntnis der Symbionten, ihrer Wohnstätten und ihrer zyklischen
Veränderungen im Lebensablauf ihrer Wirte die Lösung der physiologischen Probleme
vorbereitet, ja eine sinnvolle und planmäßige Fragestellung überhaupt erst möglich
gemacht werden kann, hoffe ich, mit dieser Arbeit gezeigt zu haben. Ließ sich doch auf rein
deskriptivem Wege, allein durch sorgfältige Analyse des gesamten symbiontischen Zyklus
zeigen, daß der schon von B ü c h n e r hypothetisch geforderte ontogenetische Zusammenhang
zweier nach ÖULC scheinbar völlig autonomer Symbiontensorten (Riesensymbionten und
Rektalsymbionten) tatsächlich besteht. Ferner bestärkt mich der Erfolg, den die Zählung
der Rektalmycetocyten mit sich brachte, in der Meinung, daß allein mit rein statistischen,
messenden und zählenden Methoden mancherlei Erkenntnisse über den wechselseitigen