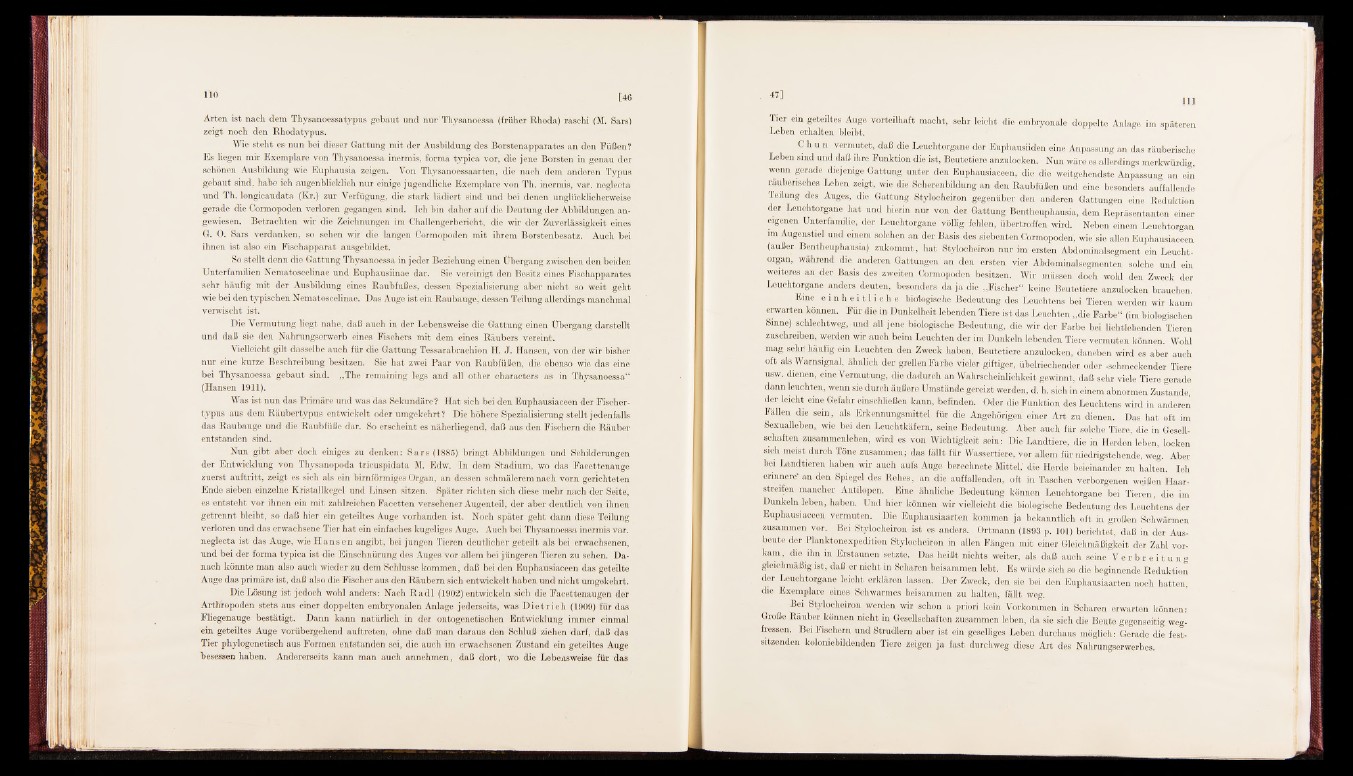
Arten ist nach dem Thysanoessatypus gebaut und nur Thysanoessa (früher Rhoda) raschi (M. Sars)
zeigt noch den Rhodatypus.
Wie steht es nun bei dieser Gattung mit der Ausbildung des Borstenapparates an den Füßen?
Es liegen mir Exemplare von Thysanoessa inermis, forma typica vor, die jene Borsten in genau der
schönen Ausbildung wie Euphausia zeigen. Von Thysanoessaarten, die nach dem anderen Typus
gebaut sind, habe ich augenblicklich nur einige jugendliche Exemplare von Th. inermis, var. neglecta
und Th. longicaudata (Kr.) zur Verfügung, die stark lädiert sind und bei denen unglücklicherweise
gerade die Cormopoden verloren gegangen sind. Ich bin daher auf die Deutung der Abbildungen angewiesen.
Betrachten wir die Zeichnungen im Challengerbericht, die wir der Zuverlässigkeit eines
G. 0. Sars verdanken, so sehen wir die langen Cormopoden mit ihrem Borstenbesatz. Auch bei
ihnen ist also ein Fischapparat ausgebildet.
So stellt denn die Gattung Thysanoessa in jeder Beziehung einen Übergang zwischen den beiden
Unterfamilien Nematoscelinae und Euphausiinae dar. Sie vereinigt den Besitz eines Fischapparates
sehr häufig mit der Ausbildung eines Raubfußes, dessen Spezialisierung aber nicht so weit geht
wie bei den typischen Nematoscelinae. Das Auge ist ein Raubauge, dessen Teilung allerdings manchmal
verwischt ist.
Die Vermutung liegt nahe, daß auch in der Lebensweise die Gattung einen Übergang darstellt
und daß sie den Nahrungserwerb eines Fischers mit dem eines Räubers vereint.
Vielleicht gilt dasselbe auch für die Gattung Tessarabrachion H. J. Hansen, von der wir bisher
nur eine kurze Beschreibung besitzen. Sie hat zwei Paar von Raubfüßen, die ebenso wie das eine
bei Thysanoessa gebaut sind. ,,The remaining legs and all other characters as in Thysanoessa“
(Hansen 1911).
Was ist nun das Primäre und was das Sekundäre? Hat sich bei den Euphausiaceen der Fischertypus
aus dem Räubertypus entwickelt oder umgekehrt? Die höhere Spezialisierung stellt jedenfalls
das Raubauge und die Raubfüße dar. So erscheint es näherliegend, daß aus den Fischern die Räuber
entstanden sind.
Nun gibt aber doch einiges zu denken: Sars (1885) bringt Abbildungen und Schilderungen
der Entwicklung von Thysanopoda tricuspidata M. Edw. In dem Stadium, wo das Facettenauge
zuerst auftritt, zeigt es sich als ein bimförmiges Organ, an dessen schmälerem nach vorn gerichteten
Ende sieben einzelne Kristallkegel und Linsen sitzen. Später richten sich diese mehr nach der Seite,
es entsteht vor ihnen ein mit zahlreichen Facetten versehener Augenteil, der aber deutlich von ihnen
getrennt bleibt, so daß hier ein geteiltes Auge vorhanden ist. Noch später geht dann diese Teilung
verloren und das erwachsene Tier hat ein einfaches kugeliges Auge. Auch bei Thysanoessa inermis var.
neglecta ist das Auge, wie Hansen angibt, bei jungen Tieren deutlicher geteilt als bei erwachsenen,
und bei der forma typica ist die Einschnürung des Auges vor allem bei jüngeren Tieren zu sehen. Danach
könnte man also auch wieder zu dem Schlüsse kommen, daß bei den Euphausiaceen das geteilte
Auge das primäre ist, daß also die Fischer aus den Räubern sich entwickelt haben und nicht umgekehrt.
Die Lösung ist jedoch wohl anders: Nach Radi (1902) entwickeln sich die Facettenaugen der
Arthropoden stets aus einer doppelten embryonalen Anlage jederseits, was Dietrich (1909) für das
Fliegenauge bestätigt. Dann kann natürlich in der ontogenetischen Entwicklung immer einmal
ein geteiltes Auge vorübergehend auftreten, ohne daß man daraus den Schluß ziehen darf, daß das
Tier phylogenetisch aus Formen entstanden sei, die auch im erwachsenen Zustand ein geteiltes Auge
besessen haben. Andererseits kann man auch annehmen, daß dort, wo die Lebensweise für das
i l LL
Tier ein geteiltes Auge vorteilhaft macht, sehr leicht die embryonale doppelte Anlage im späteren
Leben erhalten bleibt.
C h u n vermutet, daß die Leuchtorgane der Euphausiiden eine Anpassung an das räuberische
Leben sind und daß ihre Funktion die ist, Beutetiere anzulocken. Nun wäre es allerdings merkwürdig,
wenn gerade diejenige Gattung unter den Euphausiaceen, die die. weitgehendste Anpassung an ei^
räuberisches Leben zeigt, wie die Scherenbildung an den Raubfüßen und eine besonders auffallende
Teilung des Auges, die Gattung Stylocheiron gegenüber den anderen Gattungen eine Eeduktion
der Leuchtorgane hat und hierin nur von der Gattung Bentheuphausia, dem Eepräsentanten einer
eigenen Unterfamilie, der Leuchtorgane völlig fehlen, übertroffen wird. Neben einem Leuchtorgan
im Augenstiel und einem solchen an der Basis.des siebenten Cormopoden', wie sie allen Euphausiaceen
(außer Bentheuphausia) zukommt, hat. Stylocheiron nur im ersten Abdominalsegment ein Leuchtorgan,
während die anderen Gattungen an den ersten vier Abdominalsegmenten solche und ein
weiteres an. der Basis des zweiten Cormopoden besitzen. Wir müssen doch wohl den Zweck der
Leuchtorgane anders deuten, besonders da ja die „Fischer“ keine Beutetiere anzulocken brauchen.
Eine e i n h e i t l i c h e biologische Bedeutung des Leuchtern bei Tieren werden wir kaum
erwarten können. Für die in Dunkelheit lebenden Tiere ist das Leuchten „die FarbeSm biologischen
Sinne) schlechtweg, und all jene biologische Bedeutung, die wir der Farbe bei lichtlebenden Tieren
zuschreiben, werden wir auch beim Leuchten der im Dunkeln lebenden Tiere vermuten können. Wohl
mag sehn häufig ein Leuchten den Zweck haben, Beutetiere anzulocken, daneben wird es aber auch
oft als Wamsipal, ähnlich der grellen Farbe vieler giftiger, übelriechender oder -schmeckender Tiere
usw. dienen, eme Vermutung, die dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß sehr viele Tiere gerade
dann leuchten, wenn sie durch äußere Umstände gereizt werden, d. h. sich in einem abnormen Zustande,
der leicht eine Gefahr einschließen kann, befinden. Oder die Funktion des Leuchtens wird in anderen
Fällen die sein, als Erkennungsmittel für die Angehörigen einer Art zu dienen. Das hat oft im
Sexualleben,, wie bei den Leuchtkäfern, seine Bedeutung. Aber auch für solche Tiere, die in Gesellschaften
Zusammenleben, wird es von Wichtigkeit sein: Die Landtiere, die in Herden leben, locken
sich meist durch Töne zusammen; das fällt für Wassertiere, vor allem für niedrigstehende, weg. Aber
bei Landtieren haben wir auch aufs Auge berechnete Mittel,’ die Herde beieinander zu halten. Ich
erinnere’ an den Spiegel des Eehes, an die auffallenden, oft in Taschen verborgenen weißen Haarstreifen
mancher Antilopen. Eine ähnliche Bedeutung können Leuchtorgane bei Tieren, die im
Dunkeln leben, haben. Und hier können wir vielleicht die biologische Bedeutung des Leuchtens der
Euphausiaceen vermuten. Die Euphausiaarten kommen ja bekanntlich oft in großen Schwärmen
zusammen vor. Bei Stylocheiron ist es anders, Ortmann (1893 p. 101) berichtet, daß in der Ausbeute
der Planktonexpedition Stylocheiron in allen Fängen mit einer Gleichmäßigkeit der Zahl vorkam,
die ihn in Erstaunen setzte. Das heißt nichts weiter, als daß auch seine Ve r b r e i t u n g
gleichmäßig ist, daß er nicht in Scharen beisammen lebt. Es würde sich so die beginnende Eeduktion.
der Leuchtorgane leicht erklären lassen. Der Zweck, den sie bei den Euphausiaarten noch hatten,
die Exemplare eines Schwarmes beisammen zu halten, fällt weg.
Bei Stylocheiron werden wir schon a priori kein Vorkommen in Scharen erwarten können:
Große Räuber können nicht in Gesellschaften zusammen leben, da sie sich die Beute gegenseitig wegfressen.
Bei Fischern und Strudlern aber ist ein geselliges Leben, durchaus möglich: Gerade die festsitzenden
koloniebildenden Tiere zeigen ja f»st durchweg diese Art des Nahrungserwerbes.