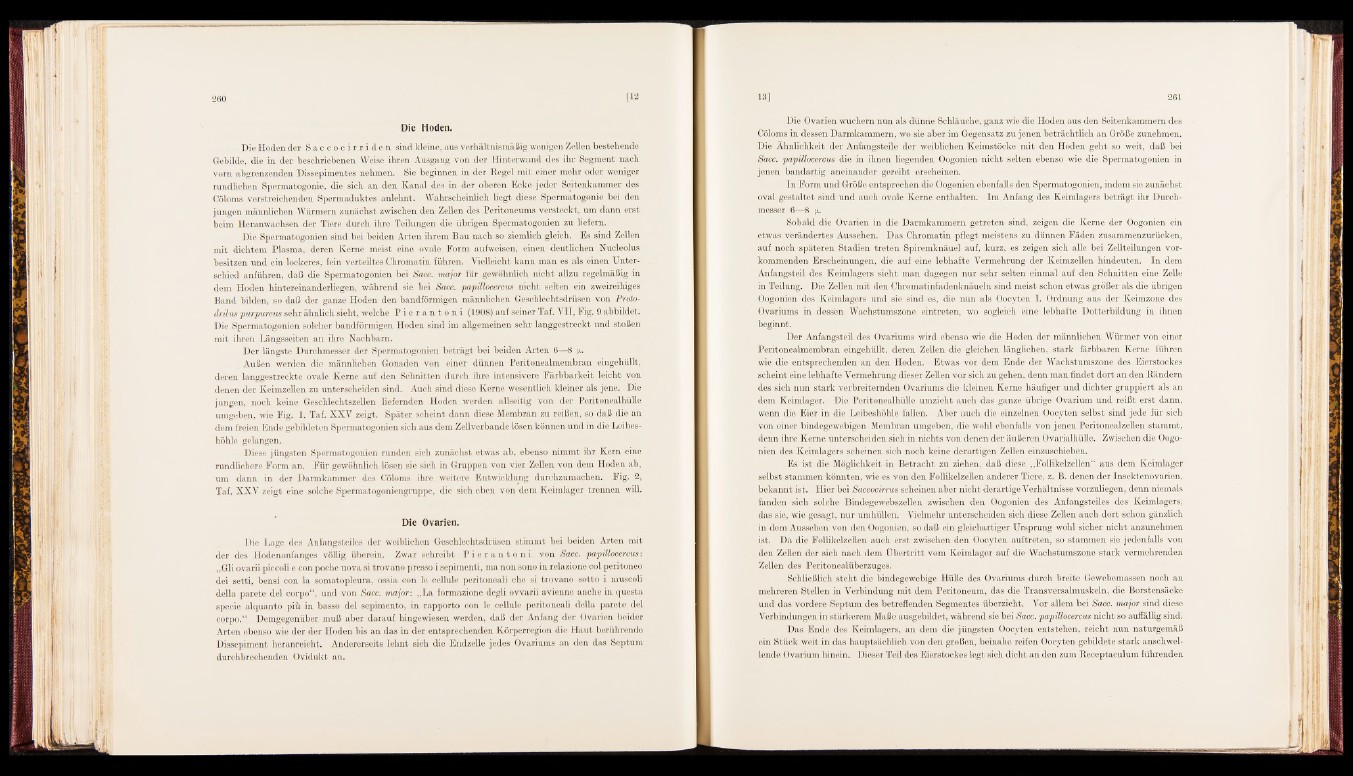
Die Hoden.
Die Hoden der S a c c o c i r r i d e n sind kleine, aus verhältnismäßig wenigen Zellen bestehende
Gebilde, die in der beschriebenen Weise ihren Ausgang von der Hinterwand des ihr Segment nach
vorn abgrenzenden Dissepimentes nehmen. Sie beginnen in der Regel mit einer mehr oder weniger
rundlichen Spermatogonie, die sich an den Kanal des in der oberen Ecke jeder Seitenkammer des
Cöloms verstreichenden Spermaduktes anlehnt. Wahrscheinlich liegt diese Spermatogonie bei den
jungen männlichen Würmern zunächst zwischen den Zellen des Peritoneums versteckt, um dann erst
beim Heranwachsen der Tiere durch ihre Teilungen die übrigen Spermatogonien zu liefern.
Die Spermatogonien sind bei beiden Arten ihrem Bau nach so ziemlich gleich. Es sind Zellen
mit dichtem Plasma, deren Kerne meist eine ovale Form aufweisen, einen deutlichen Nucleolus
besitzen und ein lockeres, fein verteiltes Chromatin führen. Vielleicht kann man es als einen Unterschied
anführen, daß die Spermatogonien bei Sacc. major für gewöhnlich nicht allzu regelmäßig in
dem Hoden hintereinanderliegen, während sie bei Sacc. papülocercus nicht selten ein zweireihiges
Band bilden, so daß der ganze Hoden den bandförmigen männlichen Geschlechtsdrüsen von Proto-
drilus purpureus sehr ähnlich sieht, welche P i e r a n t o n i (1908) auf seiner Taf. VII, Fig. 9 abbildet.
Die Spermatogonien solcher bandförmigen Hoden sind im allgemeinen sehr langgestreckt und stoßen
mit ihren Längsseiten an ihre Nachbarn.
Der längste Durchmesser der Spermatogonien beträgt bei beiden Arten 6—8 (j..
Außen werden die männlichen Gonaden von einer dünnen Peritonealmembran eingehüllt,
deren langgestreckte ovale Kerne auf den Schnitten durch ihre intensivere Färbbarkeit leicht von
denen der Keimzellen zu unterscheiden sind. Auch sind diese Kerne wesentlich kleiner als jene. Die
jungen, noch keine Geschlechtszellen liefernden Hoden werden allseitig von der Peritonealhülle
umgeben, wie Fig. 1, Taf. XXV zeigt. Später scheint dann diese Membran zu reißen, so daß die an
dem freien Ende gebildeten Spermatogonien sich aus dem Zellverbande lösen können und in die Leibeshöhle
gelangen.
Diese jüngsten Spermatogonien runden sich zunächst etwas ab, ebenso nimmt ihr Kern eine
rundlichere Form an. Für gewöhnlich lösen sie sich in Gruppen von vier Zellen von dem Hoden ab,
um dann in der Darmkammer des Cöloms ihre weitere Entwicklung durchzumachen. Fig. 2,
Taf. XXV zeigt eine solche Spermatogoniengruppe, die sich eben von dem Keimlager trennen will.
Die Ovarien.
Die Lage des Anfangsteiles der weiblichen Geschlechtsdrüsen stimmt bei beiden Arten mit
der des Hodenanfanges völlig überein. Zwar schreibt P i e r a n t o n i von Sacc. papillocercus:
„Gli ovarii piccoli e con poche uova si trovano presso i sepimenti, ma non sono in relazione col peritoneo
dei setti, bensi con la somatopleura, ossia con le cellule peritoneali che si trovano sotto i muscoli
della parete del corpo“, und von Sacc. major: „La formazione degli owarii avienne anche in questa
specie alquanto piü in basso del sepimento, in rapporto con le cellule peritoneali della parete del
corpo.“ Demgegenüber muß aber darauf hingewiesen werden, daß der Anfang der Ovarien beider
Arten ebenso wie der der Hoden bis an das in der entsprechenden Körperregion die Haut berührende
Dissepiment heranreicht. Andererseits lehnt sich die Endzeile jedes Ovariums an den das Septum
durchbrechenden Ovidukt an.
Die Ovarien wuchern nun als dünne Schläuche, ganz wie die Hoden aus den Seitenkammem des
Cöloms in dessen Darmkammern, wo sie aber im Gegensatz zu jenen beträchtlich an Größe zunehmen.
Die Ähnlichkeit der Anfangsteile der weiblichen Keimstöcke mit den Hoden geht so weit, daß bei
Sacc. papillocercus die in ihnen liegenden Oogonien nicht selten ebenso wie die Spermatogonien in
jenen bandartig aneinander gereiht erscheinen.
In Form und Größe entsprechen die Oogonien ebenfalls den Spermatogonien, indem sie zunächst
oval gestaltet sind und auch ovale Kerne enthalten. Im Anfang des Keimlagers beträgt ihr Durchmesser
6—8 y..
Sobald die Ovarien in die Darmkammern getreten sind, zeigen die Kerne der Oogonien ein
etwas verändertes Aussehen. Das Chromatin pflegt meistens zu dünnen Fäden zusammenzurücken,
auf noch späteren Stadien treten Spiremknäuel auf, kurz, es zeigen sich alle bei Zellteilungen vorkommenden
Erscheinungen, die auf eine lebhafte Vermehrung der Keimzellen hindeuten. In dem
Anfangsteil des Keimlagers sieht man dagegen nur sehr selten einmal auf den Schnitten eine Zelle
in Teilung. Die Zellen mit den Chromatinfadenknäueln sind meist schon etwas größer als die übrigen
Oogonien des Keimlagers und sie sind es, die nun als Oocyten I. Ordnung aus der Keimzone des
Ovariums in dessen Wachstumszone eintreten, wo sogleich eine lebhafte Dotterbildung in ihnen
beginnt.
Der Anfangsteil des Ovariums wird ebenso wie die Hoden der männlichen Würmer von einer
Peritonealmembran eingehüllt, deren Zellen die gleichen länglichen, stark färbbaren Kerne führen
wie die entsprechenden an den Hoden. Etwas vor dem Ende der Wachstumszone des Eierstockes
scheint eine lebhafte Vermehrung dieser Zellen vor sich zu gehen, denn man findet dort an den Rändern
des sich nun stark verbreiternden Ovariums die kleinen Kerne häufiger und dichter gruppiert als an
dem Keimlager. Die Peritonealhülle umzieht auch das ganze übrige Ovarium und reißt erst dann,
wenn die Eier in die Leibeshöhle fallen. Aber auch die einzelnen Oocyten selbst sind jede für sich
von einer bindegewebigen Membran umgeben, die wohl ebenfalls von jenen Peritonealzellen stammt,
denn ihre Kerne unterscheiden sich in nichts von denen der äußeren Ovarialhülle. Zwischen die Oogonien
des Keimlagers scheinen sich noch keine derartigen Zellen einzuschieben.
Es ist die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß diese „Follikelzellen“ aus dem Keimlager
selbst stammen könnten, wie es von den Follikelzellen anderer Tiere, z. B. denen der Insektenovarien,
bekannt ist. Hier bei Saccocirrus scheinen aber nicht derartige Verhältnisse vorzuliegen, denn niemals
fanden sich solche Bindegewebszellen zwischen den Oogonien des Anfangsteiles des Keimlagers,
das sie, wie gesagt, nur umhüllen. Vielmehr unterscheiden sich diese Zellen auch dort schon gänzlich
in dem Aussehen von den Oogonien, so daß ein gleichartiger Ursprung wohl sicher nicht anzunehmen
ist. Da die Follikelzellen auch erst zwischen den Oocyten auftreten, so stammen sie jedenfalls von
den Zellen der sich nach dem Übertritt vom Keimlager auf die Wachstumszone stark vermehrenden
Zellen des Peritonealüberzuges.
Schließlich steht die bindegewebige Hülle des Ovariums durch breite Gewebemassen noch an
mehreren Stellen in Verbindung mit dem Peritoneum, das die Transversalmuskeln, die Borstensäcke
und das vordere Septum des betreffenden Segmentes überzieht. Vor allem bei Sacc. major sind diese
Verbindungen in stärkerem Maße ausgebildet, während sie bei Sacc. papillocercus nicht so auffällig sind.
Das Ende des Keimlagers, an dem die jüngsten Oocyten entstehen, reicht nun naturgemäß
ein Stück weit in das hauptsächlich von den großen, beinahe reifen Oocyten gebildete stark anschwellende
Ovarium hinein. Dieser Teil des Eierstockes legt sich dicht an den zum Receptaculum führenden