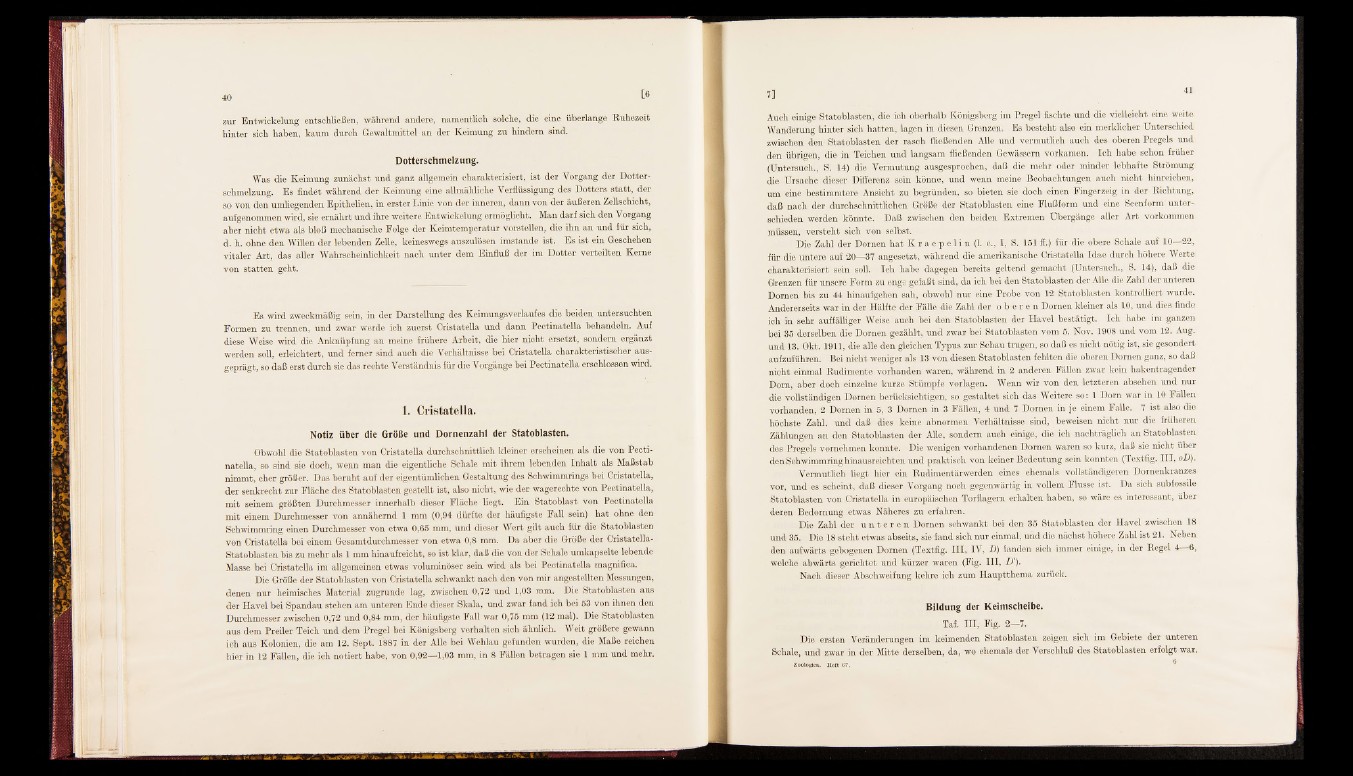
zur Entwickelung entschließen, während andere, namentlich solche, die eine überlange Ruhezeit
hinter sich haben, kaum durch Gewaltmittel an der Keimung zu hindern sind.
Dotterschmelzung.
Was die Keimung zunächst und ganz allgemein charakterisiert, ist der Vorgang der Dotterschmelzung.
Es findet während der Keimung eine allmähliche Verflüssigung des Dotters statt, der
so von den umliegenden Epithelien, in erster Rinie von der inneren, dann von der äußeren Zellschicht,
aufgenommen wird, sie ernährt und ihre weitere Entwickelung ermöglicht. Man darf sich den Vorgang
aber nicht etwa als bloß mechanische Folge der Keimtemperatur vorstellen, die ihn an und für sich,
d. h. ohne den Willen der lebenden Zelle, keineswegs auszulösen imstande ist. Es ist ein Geschehen
vitaler Art, das aller Wahrscheinlichkeit nach unter dem Einfluß der im Dotter verteilten Kerne
von statten geht.
Es wird zweckmäßig sein, in der Darstellung des Keimungsverlaufes die beiden untersuchten
Formen zu trennen, und zwar werde ich zuerst Cristatella und dann Pectinatella behandeln. Auf
diese Weise wird die Anknüpfung an meine frühere Arbeit, die hier nicht ersetzt, sondern ergänzt
werden soll, erleichtert, und ferner sind auch die Verhältnisse bei Cristatella charakteristischer ausgeprägt,
so daß erst durch sie das rechte Verständnis für die Vorgänge bei Pectinatella erschlossen wird.
1. Cristatella.
Notiz über die Größe und Dornenzahl der Statoblasten.
Obwohl die Statoblasten von Cristatella durchschnittlich kleiner erscheinen als die von Pectinatella,
so sind sie doch, wenn man die eigentliche Schale mit ihrem lebenden Inhalt als Maßstab
nimmt, eher größer. Das beruht auf der eigentümlichen Gestaltung des Schwimmrings bei Cristatella,
der senkrecht zur Fläche des Statoblasten gestellt ist, also nicht, wie der wagerechte von Pectinatella,
mit, seinem größten Durchmesser innerhalb dieser Fläche liegt. Ein Statoblast von Pectinatella
mit, einem Durchmesser von annähernd 1 mm (0,94 dürfte der häufigste Fall sein) hat ohne den
Schwimmring einen Durchmesser von etwa 0,65 mm, und dieser Wert gilt auch für die Statoblasten
von Cristatella bei einem Gesamtdurchmesser von etwa 0,8 mm. Da aber die Größe der Cristatella-
Statoblasten bis zu mehr als 1 mm hinaufreicht, so ist klar, daß die von der Schale umkapselte lebende
Masse bei Cristatella im allgemeinen etwas voluminöser sein wird als bei Pectinatella magnifica.
Die Größe der Statoblasten von Cristatella schwankt nach den von mir angestellten Messungen,
denen nur heimisches Material zugrunde lag, zwischen 0,72 und 1,03 mm. Die Statoblasten aus
der Havel bei Spandau stehen am unteren Ende dieser Skala, und zwar fand ich bei 53 von ihnen den
Durchmesser zwischen 0,72 und 0,84 mm, der häufigste Fall war 0,75 mm (12 mal). Die Statoblasten
aus dem Preiler Teich und dem Pregel bei Königsberg verhalten sich ähnlich. Weit größere gewann
ich aus Kolonien, die am 12. Sept. 1887 in der Alle bei Wehlau gefunden wurden, die Maße reichen
hier in 12 Fällen, die ich notiert habe, von 0,92—1,03 mm, in 8 Fällen betragen sie 1 mm und mehr.
Auch einige Statoblasten, die ich oberhalb Königsberg im Pregel-fischte und die vielleicht eine weite
Wanderung hinter sich hatten, lagen in diesen Grenzen. Es besteht also ein merklicher Unterschied
zwischen den Statoblasten der rasch fließenden Alle und vermutlich auch des oberen Pregels und
den übrigen, die in Teichen und langsam fließenden Gewässern vorkamen. Ich habe schon früher
(Untersuch., S. 14) die Vermutung ausgesprochen, daß die mehr oder minder lebhafte Strömung
die Ursache dieser Differenz sein könne, und wenn meine Beobachtungen auch nicht hinreichen,
um eine bestimmtere Ansicht zu begründen, so bieten sie doch einen Fingerzeig in der Richtung,
daß nach der durchschnittlichen Größe der Statoblasten eine Flußform und eine Seenform unterschieden
werden könnte. Daß zwischen den beiden Extremen Übergänge aller Art Vorkommen
müssen, versteht sich von selbst.
Die Zahl der Dornen hat K r a e p e 1 i n (1. c., I, S. 151 fl.) für die obere Schale auf 10—22,
für die untere auf 20—37 angesetzt, während die amerikanische Cristatella Idae durch höhere Werte
charakterisiert sein soll. Ich habe dagegen bereits geltend gemacht (Untersuch., S. 14), daß die
Grenzen für unsere Form zu enge gefaßt sind, da ich bei den Statoblasten der Alle die Zahl der unteren
Dornen bis zu 44 hinaufgehen sah, obwohl nur eine Probe von 12 Statoblasten kontrolliert wurde.
Andererseits war in der Hälfte der Fälle die Zahl der o b e r e n Dornen kleiner als 10, und dies finde
ich in sehr auffälliger Weise auch bei den Statoblasten der Havel bestätigt. Ich habe im ganzen
bei 35 derselben die Dornen gezählt, und zwar bei Statoblasten vom 5. Nov. 1908 und vom 12. Aug.
und 13. Okt. 1911, die alle den gleichen Typus zur Schau trugen, so daß es nicht nötig ist, sie gesondert
aufzuführen. Bei nicht weniger als 13 von diesen Statoblasten fehlten die oberen Dornen ganz, so daß
nicht einmal Rudimente vorhanden waren, während in 2 anderen Fällen zwar kein hakentragender
Dorn, aber doch einzelne kurze Stümpfe Vorlagen. Wenn wir von den letzteren absehen und nur
die vollständigen Dornen berücksichtigen, so gestaltet sich das Weitere so: 1 Dorn war in 10 Fällen
vorhanden, 2 Dornen in 5, 3 Dornen in 3 Fällen, 4 und 7 Domen in je einem Falle. 7 ist also die
höchste Zahl, und daß dies keine abnormen Verhältnisse sind, beweisen nicht nur die früheren
Zählungen an den Statoblasten der Alle, sondern auch einige, die ich nachträglich an Statoblasten
des Pregels vornehmen konnte. Die wenigen vorhandenen Dornen waren so kurz, daß sie nicht über
den Schwimmring hinausreichten und praktisch von keiner Bedeutung sein konnten (Textfig. III, oD).
Vermutlich hegt hier ein Rudimentärwerden eines ehemals vollständigeren Dornenkranzes
vor, und es scheint, daß dieser Vorgang noch gegenwärtig in vollem Flusse ist. Da sich subfossile
Statoblasten von Cristatella in europäischen Torflagern erhalten haben, so wäre es interessant, über
deren Bedornung etwas Näheres zu erfahren.
Die Zahl der u n t e r e n Dornen schwankt bei den 35 Statoblasten der Havel zwischen 18
und 35. Die 18 steht etwas abseits, sie fand sich nur einmal, und die nächst höhere Zahl ist 21. Neben
den aufwärts gebogenen Dornen (Textfig. III, IV, D) fanden sich immer einige, in der Regel 4—6,
welche abwärts gerichtet und kürzer waren (Fig. III, D').
Nach dieser Abschweifung kehre ich zum Hauptthema zurück.
Bildung der Keimscheibe.
Taf. III, Fig. 2—7.
Die ersten Veränderungen im keimenden Statoblasten zeigen sich im Gebiete der unteren
Schale, und zwar in der Mitte derselben, da, wo ehemals der Verschluß des Statoblasten erfolgt war.
Zoologica. Heft 67,