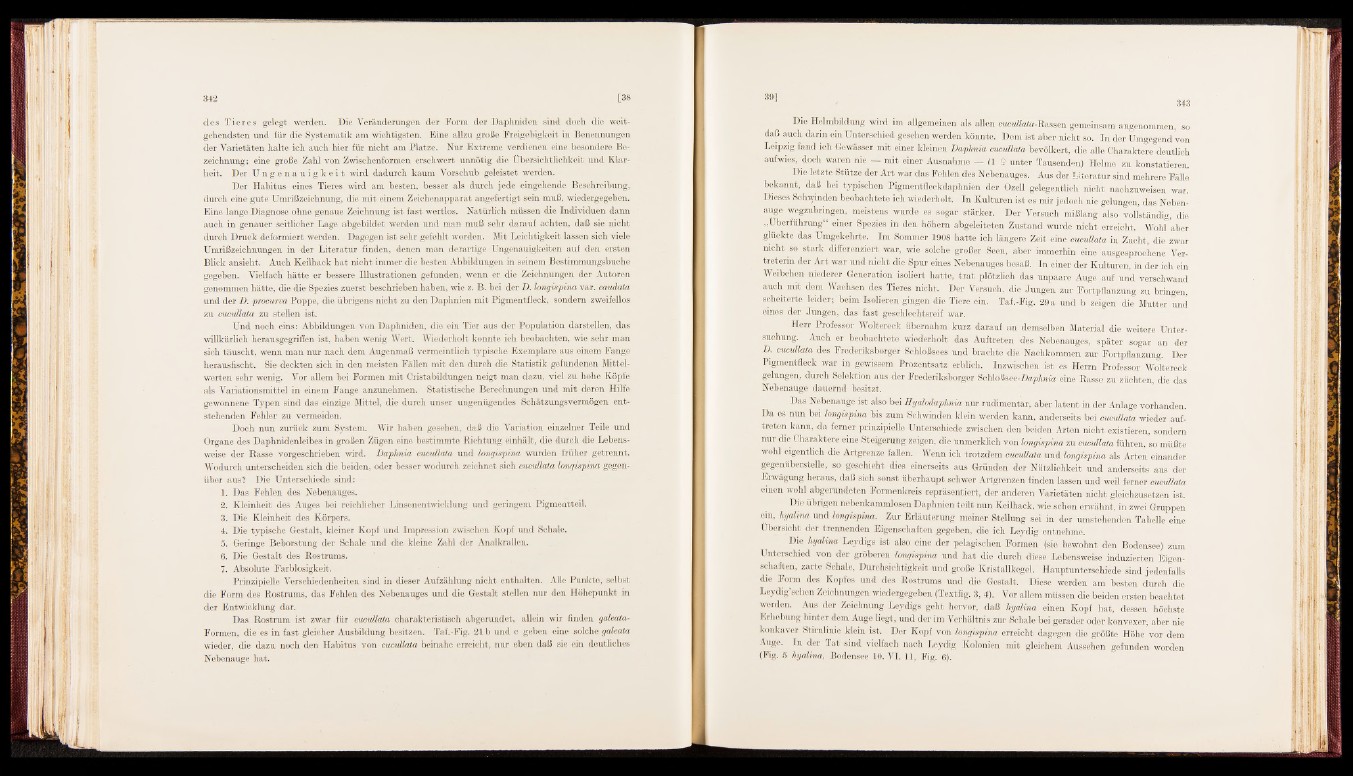
des Tieres gelegt werden. Die Veränderungen der Form der Daphniden sind doch die weitgehendsten
und für die Systematik am wichtigsten. Eine allzu große Freigebigkeit in Benennungen
der Varietäten halte ich auch hier für nicht am Platze. Nur Extreme verdienen eine besondere Bezeichnung;
eine große Zahl von Zwischenformen erschwert unnötig die Übersichtlichkeit und Klarheit.
Der U n g e n a u i g k e i t wird dadurch kaum Vorschub geleistet werden.
Der Habitus eines Tieres wird am besten, besser als durch jede eingehende Beschreibung,
durch eine gute Umrißzeichnung, die mit einem Zeichenapparat angefertigt sein muß, wiedergegeben.
Eine lange Diagnose ohne genaue Zeichnung ist fast wertlos. Natürlich müssen die Individuen dann
auch in genauer seitlicher Lage abgebildet werden und man muß sehr darauf achten, daß sie nicht
durch Druck deformiert werden. Dagegen ist sehr gefehlt worden. Mit Leichtigkeit lassen sich viele
Umrißzeichnungen in der Literatur finden, denen man derartige Ungenauigkeiten auf den ersten
Blick ansieht. Auch Keilhack hat nicht immer die besten Abbildungen in seinem Bestimmungsbuche
gegeben. Vielfach hätte er bessere Illustrationen gefunden, wenn er die Zeichnungen der Autoren
genommen hätte, die die Spezies zuerst beschrieben haben, wie z. B. bei der D. longispina var. caudata
und der D. procurva Poppe, die übrigens nicht zu den Daphnien mit Pigmentfleck, sondern zweifellos
zu cucvUata zu stellen ist.
Und noch eins: Abbildungen von Daphniden, die ein Tier aus der Population darstellen, das
willkürlich herausgegriffen ist, haben wenig Wert. Wiederholt konnte ich beobachten, wie sehr man
sich täuscht, wenn man nur nach dem Augenmaß vermeintlich typische Exemplare aus einem Fange
herausfischt. Sie deckten sich in den meisten Fällen mit den durch die Statistik gefundenen Mittelwerten
sehr wenig. Vor allem bei Formen mit Cristabildungen neigt man dazu, viel zu hohe Köpfe
als Variationsmittel in einem Fange anzunehmen. Statistische Berechnungen und mit deren Hilfe
gewonnene Typen sind das einzige Mittel, die durch unser ungenügendes Schätzungsvermögen entstehenden
Fehler zu vermeiden.
Doch nun zurück zum System. Wir haben gesehen, daß die Variation einzelner Teile und
Organe des Daphnidenleibes in großen Zügen eine bestimmte Richtung einhält, die durch die Lebensweise
der Rasse vorgeschrieben wird. Daphnia cucidlata und longispina wurden früher getrennt.
Wodurch unterscheiden sich die beiden, oder besser wodurch zeichnet sich cucullata longispina gegenüber
aus? Die Unterschiede sind:
1. Das Fehlen des Nebenauges.
2. Kleinheit des’ Auges bei reichlicher Linsenentwicklung und geringem Pigmentteil.
3. Die Kleinheit des Körpers.
4. Die typische Gestalt, kleiner Kopf und Impression zwischen Kopf und Schale.
5. Geringe Beborstung der Schale und die kleine Zahl der Analkrallen.
6. Die Gestalt des Rostrums.
7. Absolute Farblosigkeit.
Prinzipielle Verschiedenheiten sind in dieser Aufzählung nicht enthalten. Alle Punkte, selbst
die Form des Rostrums, das Fehlen des Nebenauges und die Gestalt stellen nur den Höhepunkt in
der Entwicklung dar.
Das Rostrum ist zwar für cucidlata charakteristisch abgerundet, allein wir finden galeata-
Formen, die es in fast gleicher Ausbildung besitzen. Taf.-Fig. 21b und c geben eine solche galeata
wieder, die dazu noch den Habitus von cucullata beinahe erreicht, nur eben daß sie ein deutliches
Nebenauge hat.
Die Helmbildung wird im allgemeinen als allen ciraflnfa-Rassen gemeinsam angenommen, so
daß auch darin ein Unterschied gesehen werden könnte. Dem ist aber nicht so. In der Umgegend von
Leipzig fand ich Gewässer mit einer kleinen Daphnia eucuUata bevölkert, die alle Charaktere deutlich
aufwies, doch waren nie — mit einer Ausnahme ¡¡g (1 2 unter Tausenden) Helme zu konstatieren.
Die letzte Stütze der Art war das Hehlen des Nebenauges. Aus der Literatur sind mehrere Fälle
bekannt, daß bei typischen Pigmentfleckdaphnien der Ozell gelegentlich | | h t nachzuweisen war.
Dieses Schwinden beobachtete ich wiederholt. In Kulturen ist es mir jedoch nie gelungen, das Nebenauge
wegzubringen, meistens wurde es sogar stärker. Der Versuch mißlang also vollständig, die
„Überführung“ einer Spezies in den:j$herh abgeleiteten Zustand wurde nicht erreicht Wohl aber
glückte das Umgekehrte. Im Sommer 1908 hatte ich längere Zeit eine cucullata in Zucht, die zwar
nicht so stark differenziert war, wie solche, großer Seen, aber immerhin eine ausgesprochene Vertreterin
der Art war und nicht die Spur eines Nebenauges besaß. In einer dér Kulturen, in der icfcein
Weibchen niederer Generation isoliert hatte, trat plötzlich das unpaare Aüge auf und verschwand
auch mit dem Wachsen des Tieres nicht. Der Versuch,' die Jungen zur Fortpflanzung zu bringen,
leider; beim Isolieren gingen die Tiere ein. Taf,-Fig, | | a und b zeigen die Mutter und
eines der Jungen, das fast geschlechtsreif war.
Herr Professor Woltereck übernahm kurz darauf an demselben Material die weitere Untersuchung.
Auch er beobachtete wiederholt das Auftreten des Nebenauges, später sogar an der
D. eucuUata des Frederiksborger. Schloßsees und brachte die Nachkommen zur Fortpflanzung. Der
Pigmentfleck war in gewissem Prozentsatz erblich. Inzwischen ist ipHerrn ProfesSpr Woltereck
gelungen, durch Selektion aus der Frederiksborger Schloßsee-Daptab eine Rasse zu züchten, die das
Nebenäuge dauernd besitzt.
Das Nebenauge ist also bei Hyalodaphnia nur rudimentär, aber latent in der Anlage vorhanden.
Da es nun bei longispina bis zum Schwinden klein Werden kann, anderseits bei amUata wieder auf-
treten kann, da ferner prinzipielle Unterschiede zwischen den beiden Arten nicht existieren, sondern
nur die Charaktere eine Steigerung zeigen, die unmerklich von longispina zu cucullata führen, so müßte
wohl eigentlich die Artgrenze fallen. Wenn ich trotzdem eueullata und longispina als Arten d ~ n k r
gegenubersteile, so geschieht dies einerseits aus Gründen der Nützlichkeit und anderseits aus der
Erwägung heraus, daß sich sonst überhaupt.sehwer Artgrenzen finden lassen und weil ferner cucullata
einen wohl abgerundeten Formenkreis repräsentiert, der anderen Varietäten nicht gleichzusetzen ist
Die übrigen nebenkammlosen Daphnien teilt nun Keilhack, wie schon erwähnt, in zwei Gruppen
ein, hyalim und longispina. Zur Erläuterung meiner Stellung se! in der umstehenden Tabelle eine
Übersicht der trennenden Eigenschaften gegeben, die ich Leydig-chtnehme.
Die hyalma Leydigs ist also eine der pelagischen Formen (sie bewohnt den Bödensee) zum
Unterschied von der gröberen longispina und hat die durch diese Lebensweise induzierten Eigenschaften,
zarte Schale, Durchsichtigkeit und große Kristallkegei:' Hauptunterschiede sind jedenfalls
die Form des Kopfes und des Rostrums und die Gestalt. "Diese werden am besten durch die
Leydig’schen Zeichnungen wiedergegeben (Textfig. 3, i). Vor allem müssen die beiden ersten beachtet
werden. Aus der Zeichnung Leydigs geht hervor, daß hyalma einen Kopf hat, dessen höchste
Erhebung hinter dem Auge liegt, und der im Verhältnis zur Schale bei gerader oder konvexer, aber nie
konkaver Stirnlinie klein ist. Der Kopf von longispina erreicht dagegen die größte Höhe vor dem
Auge. In der Tat sind vielfach nach Leydig Kolonien mit gleichem Aussehen gefunden Worden
(Fig. 5 hyalina, Bodensee 10. VI. 11, Fig. 6).