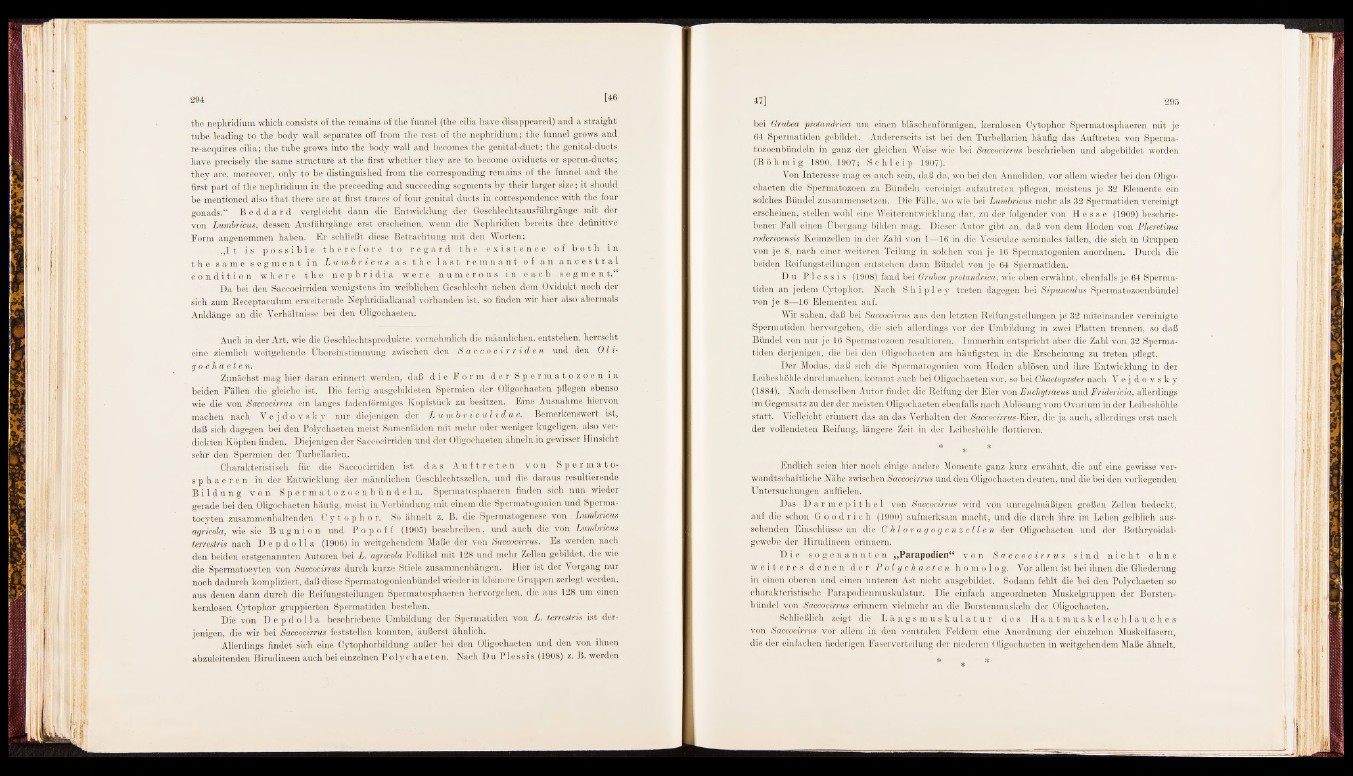
the nephridium which consists of the remains of the funnel (the cilia have disappeared) and a straight
tube leading to the body wall separates off from the rest of the nephridium; the funnel grows and
re-acquires cilia; the tube grows into the body wall and becomes the genital-duct; the genital-ducts
have precisely the same structure at the first whether they are to become oviducts or sperm-ducts;
they are, moreover, only to be distinguished from the corresponding remains of the funnel and the
first part of the nephridium in the preceeding and succeeding segments by their larger size; it should
be mentioned also that there are at first traces of four genital ducts in correspondence with the four
gonads.“ B e d d a r d vergleicht dann die Entwicklung der Geschlechtsausführgänge mit der
von Lumbricus, dessen Ausführgänge erst erscheinen, wenn die Nephridien bereits ihre definitive
Form angenommen haben. Er schließt diese Betrachtung mit den Worten:
„I t is p o s s i b l e t h e r e f o r e to r e g a r d t h e e x i s t e n c e of b o t h in
t h e s ame s e gm e n t in L u m b r i c u s as t h e l a s t r em n a n t of an a n c e s t r a l
c o n d i t i o n wh e r e t h e n e p h r i d i a we r e n ume r o u s in e a c h s e gme n t . “
Da bei den Saccocirriden wenigstens im weiblichen Geschlecht neben dem Ovidukt noch der
sich zum Receptaculum erweiternde Nephridialkanal vorhanden ist, so finden wir hier also abermals
Anklänge an die Verhältnisse bei den Oligochaeten.
Auch in der Art, wie die Geschlechtsprodukte, vornehmlich die männlichen, entstehen, herrscht
eine ziemlich weitgehende Übereinstimmung zwischen den S a c c o c i r r i d e n und den Ol i gochaeten.
Zunächst mag hier daran erinnert werden, daß d ie F o r m de r S p e rm a t o z o e n i n
beiden Fällen die gleiche ist. Die fertig ausgebildeten Spermien der Oligochaeten pflegen ebenso
wie die von Saccocirrus ein langes fadenförmiges Kopfstück zu besitzen. Eine Ausnahme hiervon
machen nach V e j d o v s k y nur diejenigen der L u mb r ic u l id a e. Bemerkenswert ist,
daß sich dagegen bei den Polychaeten meist Samenfäden mit mehr oder weniger kugeligen, also verdickten
Köpfen finden. Diejenigen der Saccocirriden und der Oligochaeten ähneln in gewisser Hinsicht
sehr den Spermien der Turbellarien.
Charakteristisch für die Saccocirriden ist d a s A u f t r e t e n von Sp e rma t o -
s p h a e r e n in der Entwicklung der männlichen Geschlechtszellen, und die daraus resultierende
B i l d u n g von S p e r m a t o z o e n b ü n d e l n . Spermatosphaeren finden sich nun wieder
gerade bei den Oligochaeten häufig, meist in Verbindung mit einem die Spermatogonien und Sperma-
tocyten zusammenhaltenden Cyt ophor . So ähnelt z. B. die Spermatogenese von Lumbricus
agricola, wie sie B u g n i o n und Pop of f (1905) beschreiben, und auch die von Lumbricus
terrestris nach D e p d o 11 a (1906) in weitgehendem Maße der von Saccocirrus. Es werden nach
den beiden erstgenannten Autoren bei L. agricola Follikel mit 128 und mehr Zellen gebildet, die wie
die Spermatocyten von Saccocirrus durch kurze Stiele Zusammenhängen. Hier ist der Vorgang nur
noch dadurch kompliziert, daß diese Spermatogonienbündel wieder in kleinere Gruppen zerlegt werden,
aus denen dann durch die Reifungsteilungen Spermatosphaeren hervorgehen, die aus 128 um einen
kernlosen Cytophor gruppierten Spermatiden bestehen.
Die von De p d o l l a beschriebene Umbildung der Spermatiden von L. terrestris ist derjenigen,
die wir bei Saccocirrus feststellen konnten, äußerst ähnlich.
Allerdings findet sich eine Cytophorbildung außer bei den Oligochaeten und den von ihnen
abzuleitenden Hirudineen auch bei einzelnen P oly ch a et en. Nach D uP le ssis (1908) z. B. werden
bei Grubea protandrica um einen bläschenförmigen, kernlosen Cytophor Spermatosphaeren mit je
64 Spermatiden gebildet. Andererseits ist bei den Turbellarien häufig das Auftreten von Spermatozoenbündeln
in ganz der gleichen Weise wie bei Saccocirrus beschrieben und abgebildet worden
(Böhmig 1890, 1907; S c h l e i p 1907).
Von Interesse mag es auch sein, daß da, wo bei den Anneliden, vor allem wieder bei den Oligochaeten
die Spermatozoen zu Bündeln vereinigt aufzutreten pflegen, meistens je 32 Elemente ein
solches Bündel zusammensetzen. Die Fälle, wo wie bei Lumbricus mehr als 32 Spermatiden vereinigt
erscheinen, stellen wohl eine Weiterentwicklung dar, zu der folgender von He s s e (1909) beschriebener
Fall einen Übergang bilden mag. Dieser Autor gibt an, daß von dem Hoden von Pheretima
rodericensis Keimzellen in der Zahl von 1—16 in die Vesiculae seminales fallen, die sich in Gruppen
von je 8, nach einer weiteren Teilung in solchen von je 16 Spermatogonien anordnen. Durch die
beiden Reifungsteilungen entstehen dann Bündel von je 64 Spermatiden.
Du P l e s s i s (1908.) fand bei Grubea protandrica, wie oben erwähnt, ebenfalls je 64 Spermatiden
an jedem Cytophor. Nach S h i p 1 e y treten dagegen bei Sipunctdus Spermatozoenbündel
von je- 8—16 Elementen auf.
Wir sahen, daß bei Saccocirrus aus den letzten Reifungsteilungen je 32 miteinander vereinigte
Spermatiden hervorgehen, die sich allerdings vor der Umbildung in zwei Platten trennen, so daß
Bündel von nur je 16 Spermatozoen resultieren. Immerhin entspricht aber die Zahl von 32 Spermatiden
derjenigen, die bei den Oligochaeten am häufigsten in die Erscheinung zu treten pflegt.
Der Modus, daß sich die Spermatogonien vom Hoden ablösen und ihre Entwicklung in der
Leibeshöhle durchmachen, kommt auch bei Oligochaeten vor, so bei Chaetogaster nach Vej d o v s k y
(1884). Nach demselben Autor findet die Reifung der Eier von Enchytraeus und Fridericia, allerdings
im Gegensatz zu der der meisten Oligochaeten ebenfalls nach Ablösung vom Ovarium in der Leibeshöhle
statt. Vielleicht erinnert das an das Verhalten der Saccocirrus-Fiiei, die ja auch, allerdings erst nach
der vollendeten Reifung, längere Zeit in der Leibeshöhle flottieren.
* *I *
Endlich seien hier noch einige andere Momente ganz kurz erwähnt, die auf eine gewisse verwandtschaftliche
Nähe zwischen Saccocirrus und den Oligochaeten deuten, und die bei den vorliegenden
Untersuchungen auffielen.
Das D a rm e p i t h e l von Saccocirrus wird von unregelmäßigen großen Zellen bedeckt,
auf die schon Go od r i c h (1900) aufmerksam macht, und die durch ihre im Leben gelblich aussehenden
Einschlüsse an die Chlor ag og en z e l l en der Oligochaeten und der Bothryoidal-
gewebe der Hirudineen erinnern.
D ie s o g e n a n n t e n „Parapodien“ v o n S a c c o c i r r u s s i nd n i c h t ohne
w e i t e r e s d e n e n de r P o l y c h a e t e n homolog. Vor allem ist bei ihnen die Gliederung
in einen oberen und einen unteren Ast nicht ausgebildet. Sodann fehlt die bei den Polychaeten so
charakteristische Parapodienmuskulatur. Die einfach angeordneten Muskelgruppen der Borstenbündel
von Saccocirrus erinnern vielmehr an die Borstenmuskeln der Oligochaeten.
Schließlich zeigt die L ä n g sm u s k u l a t u r des H a u tmu s k e 1 S c h l a u c h e s
von Saccocirrus vor allem in den ventralen Feldern eine Anordnung der einzelnen Muskelfasern,
die der einfachen fiederigen Faserverteilung der niederen Oligochaeten in weitgehendem Maße ähnelt.
* ** *