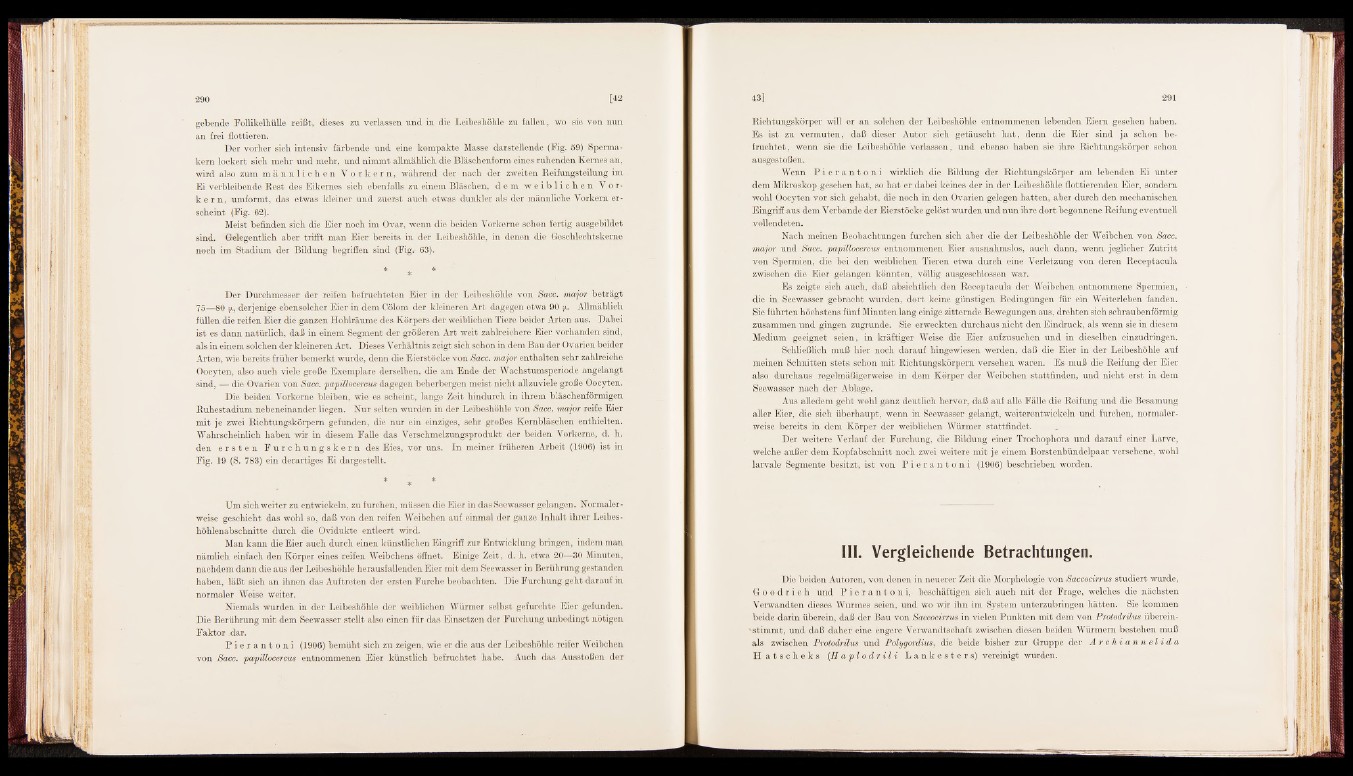
gebende Follikelhülle reißt, dieses zu verlassen und in die Leibesböble zu fallen, wo sie von nun
an frei flottieren.
Der vorher sieb intensiv färbende und eine kompakte Masse darstellende (Fig. 59) Spermakern
lockert sieb mehr und mehr, und nimmt allmählich die Bläschenform eines ruhenden Kernes an,
wird also zum mä n n l i c h e n V o r k e r n , während der nach der zweiten Reifungsteilung im
Bi verbleibende Rest des Eikernes sich ebenfalls zu einem Bläschen, d em w e i b l i c h e n Vor ke
r n, umformt, das etwas kleiner und zuerst auch etwas dunkler als der männliche Yorkern erscheint
(Fig. 62).
Meist befinden sich die Eier noch im Ovar, wenn die beiden Vorkerne schon fertig ausgebildet
sind. Gelegentlich aber trifft man Eier bereits in der Leibeshöhle, in denen die Geschlechtskerne
noch im Stadium der Bildung begriffen sind (Fig. 63).
* * *
Der Durchmesser der reifen befruchteten Eier in der Leibeshöhle von Sacc. major beträgt
75—80 y., derjenige ebensolcher Eier in dem Cölom der kleineren Art dagegen etwa 90 n. Allmählich
füllen die reifen Eier die ganzen Hohlräume des Körpers der weiblichen Tiere beider Arten aus. Dabei
ist es dann natürlich, daß in einem Segment der größeren Art weit zahlreichere Eier vorhanden sind,
als in einem solchen der kleineren Art. Dieses Verhältnis zeigt sich schon in dem Bau der Ovarien beider
Arten, wie bereits früher bemerkt wurde, denn die Eierstöcke von Sacc. major enthalten sehr zahlreiche
Oocyten, also auch viele große Exemplare derselben, die am Ende der Wachstumsperiode angelangt
sind, — die Ovarien von Sacc. papülocercus dagegen beherbergen meist nicht allzuviele große Oocyten.
Die beiden Vorkerne bleiben, wie es scheint, lange Zeit hindurch in ihrem bläschenförmigen
Ruhestadium nebeneinander liegen. Nur selten wurden in der Leibeshöhle von Sacc. major reife Eier
mit je zwei Richtungskörpem gefunden, die nur ein einziges, sehr großes Kernbläschen enthielten.
Wahrscheinlich haben wir in diesem Falle das Verschmelzungsprodukt der beiden Vorkerne, d. h.
den e r s t e n F u r c h u n g s k e r n des Eies, vor uns. In meiner früheren Arbeit (1906) ist in
Fig. 19 (S. 783) ein derartiges Ei dargestellt.
* * *
Um sich weiter zu entwickeln, zu furchen, müssen die Eier in dasSeewasser gelangen. Normalerweise
geschieht das wohl so, daß von den reifen Weibchen auf einmal der ganze Inhalt ihrer Leibeshöhlenabschnitte
durch die Ovidukte entleert wird.
Man kann die Eier auch durch einen künstlichen Eingriff zur Entwicklung bringen, indem man
nämlich einfach den Körper eines reifen Weibchens öffnet. Einige Zeit, d. h. etwa 20—30 Minuten,
nachdem dann die aus der Leibeshöhle herausfallenden Eier mit dem Seewasser in Berührung gestanden
haben, läßt sich an ihnen das Auftreten der ersten Furche beobachten. Die Furchung-geht darauf in
normaler Weise weiter.
Niemals wurden in der Leibeshöhle der weiblichen Würmer selbst gefurchte Eier gefunden.
Die Berührung mit dem Seewasser stellt also einen für das Einsetzen der Furchung unbedingt nötigen
Faktor .dar.
P i e r a n t o n i (1906) bemüht sich zu zeigen, wie er die aus der Leibeshöhle reifer Weibchen
von Sacc. papülocercus entnommenen Eier künstlich befruchtet habe. Auch das Ausstößen der
Richtungskörper will er an solchen der Leibeshöhle entnommenen lebenden Eiern gesehen haben.
Es ist zu vermuten, daß dieser Autor sich getäuscht hat, denn die Eier sind ja schon befruchtet,
wenn sie die Leibeshöhle verlassen, und ebenso haben sie ihre Richtungskörper schon
ausgestößen.
Wenn P i e r a n t o n i wirklich die Bildung der Richtungskörper am lebenden Ei unter
dem Mikroskop gesehen hat, so hat er dabei keines der in der Leibeshöhle flottierenden Eier, sondern
wohl Oocyten vor sich gehabt, die noch in den Ovarien gelegen hatten, aber durch den mechanischen
Eingriff aus dem Verbände der Eierstöcke gelöst wurden und nun ihre dort begonnene Reifung eventuell
vollendeten.
Nach meinen Beobachtungen furchen sich aber die der Leibeshöhle der Weibchen von Sacc.
major und Sacc. papillocercus entnommenen Eier ausnahmslos, auch dann, wenn jeglicher Zutritt
von Spermien, die bei den weiblichen Tieren etwa durch eine Verletzung von deren Receptacula
zwischen die Eier gelangen könnten, völlig ausgeschlossen war.
Es zeigte sich auch, daß absichtlich den Receptacula der Weibchen entnommene Spermien,
die in Seewasser gebracht wurden, dort keine günstigen Bedingungen für ein Weiterleben fanden.
Sie führten höchstens fünf Minuten lang einige zitternde Bewegungen aus, drehten sich schraubenförmig
zusammen und gingen zugrunde. Sie erweckten durchaus nicht den Eindruck, als wenn sie in diesem
Medium geeignet seien, in kräftiger Weise die Eier aufzusuchen und in dieselben einzudringen.
Schließlich muß hier noch darauf hingewiesen werden, daß die Eier in der Leibeshöhle auf
meinen Schnitten stets schon mit Richtungskörpern versehen waren. Es muß die Reifung der Eier
also durchaus regelmäßigerweise in dem Körper der Weibchen stattfinden, und nicht erst in dem
Seewasser nach der Ablage.
Aus alledem geht wohl ganz deutlich hervor, daß auf alle Fälle die Reifung und die Besamung
aller Eier, die sich überhaupt, wenn in See wasser gelangt, weiterentwickeln und furchen, normaler-
weise bereits in dem Körper der weiblichen Würmer stattfindet.
Der weitere Verlauf der Furchung, die Bildung einer Trochophora und darauf einer Larve,
welche außer dem Kopfabschnitt noch zwei weitere mit je einem Borstenbündelpaar versehene, wohl
larvale Segmente besitzt, ist von P i e r a n t o n i (1906) beschrieben worden.
III. Vergleichende Betrachtungen.
Die beiden Autoren, von denen in neuerer Zeit die Morphologie von Saccocirrus studiert wurde,
G o o d r i c h und P i e r a n t o n i , beschäftigen sieh .auch mit der Frage, welches die nächsten
Verwandten dieses Wurmes seien, und wo wir ihn im System unterzubringen hätten. Sie kommen
beide darin überein, daß der Bau von Saccocirrus in vielen Punkten mit dem von Protodrüus überein-
* stimmt, und daß daher eine engere Verwandtschaft zwischen diesen beiden Würmern bestehen muß
als zwischen Protodrüus und Pölygordius, die beide bisher zur Gruppe der A r c h i a n n e l i d a
H a t s c h e k s (Ha p l o dr i l i L a n k e s t e r s ) vereinigt wurden.