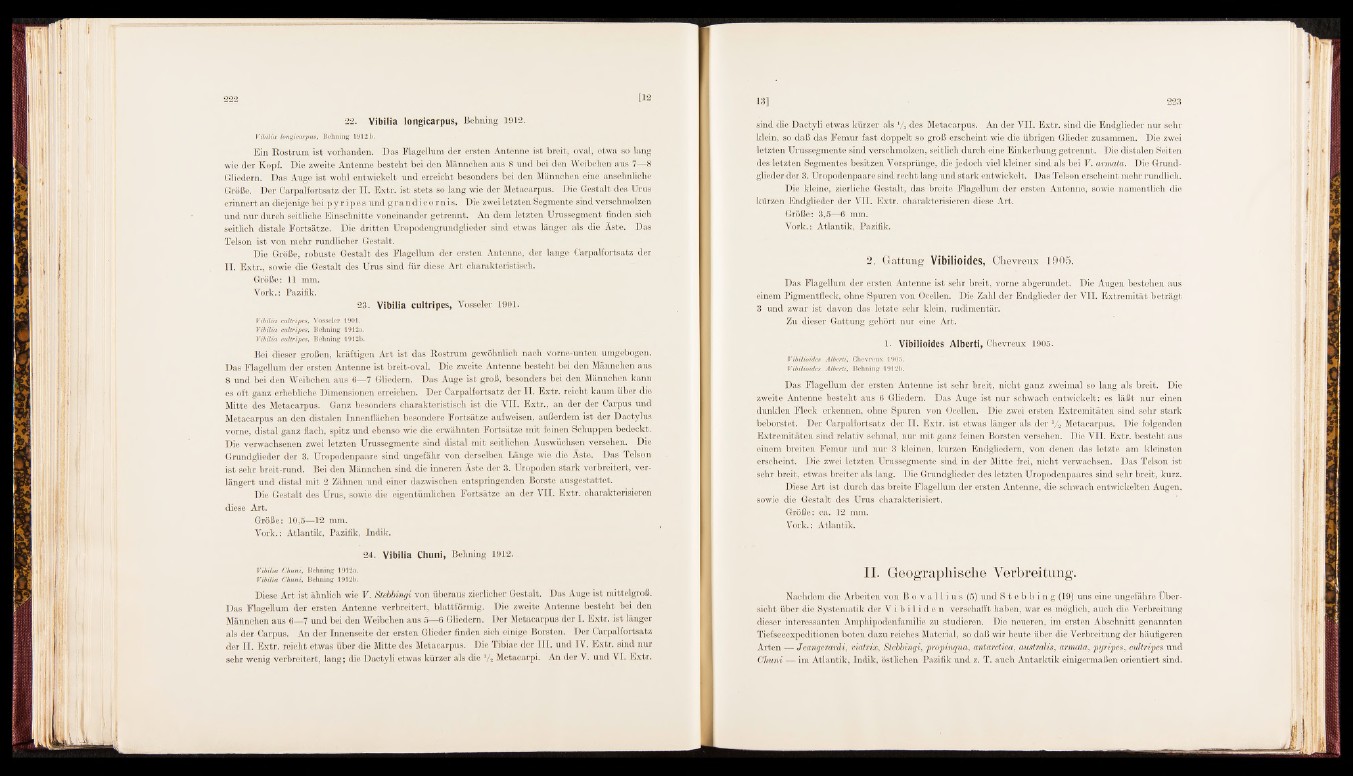
22. vibilia longicarpus, Beinling 1912.
Vib ilia longicarpus, Behning 1912 b.
Ein Kostrum ist vorhanden. Das Flagellum der ersten Antenne ist breit, oval, etwa so lang
wie der Kopf. Die zweite Antenne besteht bei den Männchen aus 8 und bei den Weibchen aus 7—8
Gliedern. Das Auge ist wohl entwickelt und erreicht besonders bei den Männchen eine ansehnliche
Größe. Der Carpalfortsatz der II. Extr. ist stets so lang wie der Metacarpus. Die Gestalt des Urus
erinnert an diejenige bei py rip es und grandicornis. Die'zwei letzten Segmente sind verschmolzen
und nur durch seitliche Einschnitte voneinander getrennt. An dem letzten Urussegment finden sich
seitlich distale Fortsätze. Die dritten Uropodengrundglieder sind etwas länger als die Äste. Das
Telson ist von mehr rundlicher Gestalt.
Die Größe, robuste Gestalt des Flagellum der ersten Antenne, der lange Carpalfortsatz der
II. Extr., sowie die Gestalt des Urus sind für diese Art charakteristisch.
Größe: 11 mm.
York.: Pazifik.
23. Vibilia cultripes, Vosseier 1901.
Vibilia cultripes, Vosseier 1901.
V ibilia cultripes, Behning 1912a.
V ibilia cultripes, Behning 1912b.
Bei dieser großen, kräftigen Art ist das Rostrum gewöhnlich nach vorne-unten umgebogen.
Das Flagellum der ersten Antenne ist breit-oval. Die zweite Antenne besteht bei den Männchen aus
8 und bei den Weibchen aus 6—7 Gliedern. Das Auge ist groß, besonders bei den Männchen kann
es oft ganz erhebliche Dimensionen erreichen. Der Carpalfortsatz der II. Extr. reicht kaum über die
Mitte des Metacarpus. Ganz besonders charakteristisch ist die VII. Extr., an der der Carpus und
Metacarpus an den distalen Innenflächen besondere Fortsätze aufweisen, außerdem ist der Dactylus
vorne, distal ganz flach, spitz und ebenso wie die erwähnten Fortsätze mit feinen Schuppen bedeckt.
Die verwachsenen zwei letzten Urussegmente sind distal mit seitlichen Auswüchsen versehen. Die
Grundglieder der 3. Uropodenpaare sind ungefähr von derselben Länge wie die Äste. Das Telson
ist sehr breit-rund. Bei den Männchen sind die inneren Äste der 3. Uropoden stark verbreitert, verlängert
und distal mit 2 Zähnen und einer dazwischen entspringenden Borste ausgestattet.
Die Gestalt des Urus, sowie die eigentümlichen Fortsätze an der VII. Extr. charakterisieren
diese Art.
Größe: 10,5—12 mm.
Vork.: Atlantik, Pazifik, Indik.
24. Vibilia Chuni, Behning 1912.
V ibilia Chuni, Behning 1912a.
Vibilia Chuni, Behning 1912b.
Diese Art ist ähnlich wie F. Stebbingi von überaus zierlicher Gestalt. Das Auge ist mittelgroß.
Das Flagellum der ersten Antenne verbreitert, blattförmig. Die zweite Antenne besteht bei den
Männchen aus 6—7 und bei den Weibchen aus 5—6 Gliedern. Der Metacarpus der I. Extr. ist länger
als der Carpus. An der Innenseite der ersten Glieder finden sich einige Borsten. Der Carpalfortsatz
der II. Extr. reicht etwas über die Mitte des Metacarpus. Die Tibiae der III. und IV. Extr. sind nur
sehr wenig verbreitert, lang; die Dactyli etwas kürzer als die Va Metacarpi. An der V. und VI. Extr.
sind die Dactyli etwas kürzer als Vs des Metacarpus. An der VII. Extr. sind die Endglieder nur sehr
klein, so daß das Femur fast doppelt so groß erscheint wie die übrigen Glieder zusammen. Die zwei
letzten Urussegmente sind verschmolzen, seitlich durch eine Einkerbung getrennt. Die distalen Seiten
des letzten Segmentes besitzen Vorsprünge, die jedoch viel kleiner sind als bei F. armata. Die Grundglieder
der 3. Uropodenpaare sind recht lang und stark entwickelt. Das Telson erscheint mehr rundlich.
Die kleine, zierliche Gestalt, das breite Flagellum der ersten Antenne, sowie namentlich die
kürzen Endglieder der. VII. Extr. charakterisieren diese Art.
Größe: 3,5—6 mm.
Vork.: Atlantik, Pazifik.
2. Gattung Vibilioides, Chevreux 1905.
Das Flagellum der ersten Antenne ist sehr breit, vorne abgerundet. Die Augen bestehen aus
einem Pigmentfleck, ohne Spuren von Ocellen. Die Zahl der Endglieder der VII. Extremität beträgt
3 und zwar ist davon das letzte sehr klein, rudimentär.
Zu dieser Gattung gehört nur eine Art.
1. Vibilioides Alberti, Chevreux 1905.
VibilioidJes Alberti, Chevreux 1905.
Vibilioides Alberti, Behning 1912b.
Das Flagellum der ersten Antenne ist sehr breit, nicht ganz zweimal so lang als breit. Die
zweite Antenne besteht aus 6 Gliedern. Das Auge ist nur schwach entwickelt: es läßt nur einen
dunklen Fleck erkennen, ohne Spuren von Ocellen. Die zwei ersten Extremitäten sind sehr stark
beborstet. Der Carpalfortsatz der II. Extr. ist etwas länger als der y2 Metacarpus. Die folgenden
Extremitäten sind relativ schmal, nur mit ganz feinen Borsten versehen. Die VII. Extr. besteht aus
einem breiten Femur und nur 3 kleinen, kurzen Endgliedern, von denen das letzte am kleinsten
erscheint. Die zwei letzten Urussegmente sind in der Mitte frei, nicht verwachsen. Das Telson ist
sehr breit, etwas breiter als lang. Die Grundglieder des letzten Uropodenpaares sind sehr breit, kurz.
Diese Art ist durch das breite Flagellum der ersten Antenne, die schwach entwickelten Augen,
sowie die Gestalt des Urus charakterisiert.
Größe: ca. 12 mm.
Vork.: Atlantik.
II. Geographische Verbreitung.
Nachdem die Arbeiten von B o v a l l i u s (5) und S t e b b i n g (19) uns eine ungefähre Übersicht
über die Systematik der V i b i l i d e n verschafft haben, war es möglich, auch die Verbreitung
dieser interessanten Amphipodenfamilie zu studieren. Die neueren, im ersten Abschnitt genannten
Tiefseeexpeditionen boten dazu reiches Material, so daß wir heute über die Verbreitung der häufigeren
Arten — Jeangerardi, viatrix, Stebbingi, propingua, antárctica, australis, armata, pyripes, cultripes und
Chuni — im Atlantik, Indik, östlichen Pazifik und z. T. auch Antarktik einigermaßen orientiert sind.