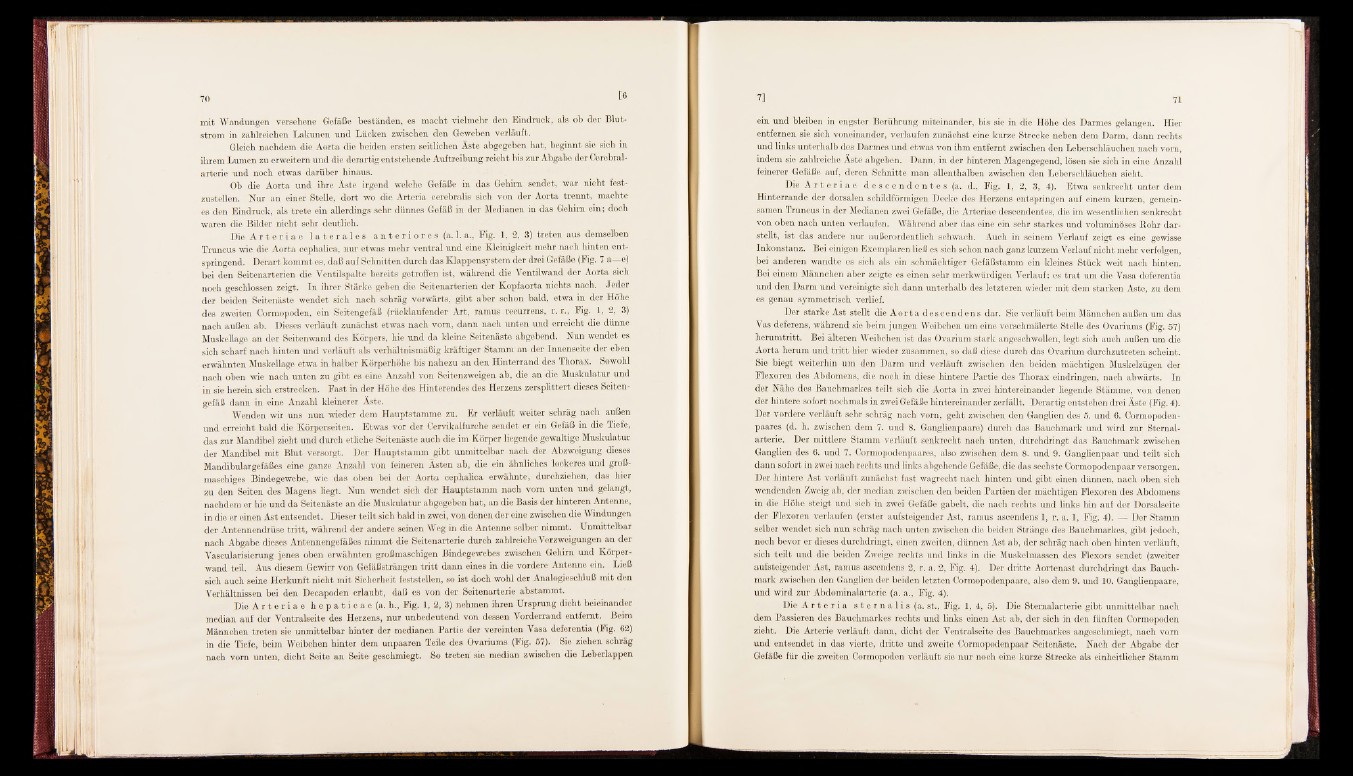
mit Wandungen versehene Gefäße beständen, es macht vielmehr den Eindruck, als ob der Blutstrom
in zahlreichen Lakunen und Lücken zwischen den Geweben verläuft.
Gleich nachdem die Aorta die beiden ersten seitlichen Äste abgegeben hat, beginnt sie sich in
ihrem Lumen zu erweitern und die derartig entstehende Auftreibung reicht bis zur Abgabe der Cerebralarterie
und noch etwas darüber hinaus.
Ob die Aorta und ihre Äste irgend welche Gefäße in das Gehirn sendet, war nicht festzustellen.
Nur an einer Stelle, dort wo die Arteria cerebralis sich von der Aorta trennt, machte
es den Eindruck, als trete ein allerdings sehr dünnes Gefäß in der Medianen in das Gehirn ein; doch
waren die Bilder nicht sehr deutlich.
Die Ar t e r i a e l a t e r a l e s a n t e r i o r e s (a. 1. a., Fig. 1, 2, 3) treten aus demselben
Truncus wie die Aorta cephalica, nur etwas mehr ventral und eine Kleinigkeit mehr nach hinten entspringend.
Derart kommt es, daß auf Schnitten durch das Klappensystem der drei Gefäße (Fig. 7 fe e )
bei den Seitenarterien die Ventilspalte bereits getroffen ist, während die Ventilwand der Aorta sich
noch geschlossen zeigt. In ihrer Stärke geben die Seitenarterien der Kopfaorta nichts nach. Jeder
der beiden Seitenäste wendet sich nach schräg vorwärts, gibt aber schon bald, etwa in der Höhe
des zweiten Cormopoden, ein Seitengefäß (rücklaufender Art, ramüs recurrens, r. r., Fig. 1, 2, 3)
nach außen ab. Dieses verläuft zunächst etwas nach vorn, dann nach unten und erreicht die dünne
Muskellage an der Seitenwand des Körpers, hie und da kleine Seitenäste abgebend. Nun wendet es
sich scharf nach hinten und verläuft als verhältnismäßig kräftiger Stamm an der Innenseite der eben
erwähnten Muskellage etwa in halber Körperhöhe bis nahezu an den Hinterrand des Thorax. Sowohl
nach oben wie nach unten zu gibt es eine Anzahl von Seitenzweigen ab, die an die Muskulatur und
in sie herein sich erstrecken. Fast in der Höhe des Hinterendes des Herzens zersplittert dieses Seitengefäß
dann in eine Anzahl kleinerer Äste.
Wenden wir uns nun wieder dem Hauptstamme zu. Er verläuft weiter schräg nach außen
und erreicht bald die Körperseiten. Etwas vor der Cervikalfurche sendet er ein Gefäß in die Tiefe,
das zur Mandibel zieht und durch etliche Seitenäste auch die im Körper Hegende gewaltige Muskulatur
der Mandibel mit Blut versorgt. Der Hauptstamm gibt unmittelbar nach der Abzweigung dieses
Mandibulargefäßes eine ganze Anzahl von feineren Ästen ab, die ein ähnliches lockeres und großmaschiges
Bindegewebe, wie das oben bei der Aorta cephahca erwähnte, durchziehen, das hier
zu den Seiten des Magens liegt. Nun wendet sich der Hauptstamm nach vorn unten und gelangt,
nachdem er hie und da Seitenäste an die Muskulatur abgegeben hat, an die Basis der hinteren Antenne,
in die er einen Ast entsendet. Dieser teilt sich bald in zwei, von denen der eine zwischen die Windungen
der Antennendrüse tritt, während der andere seinen Weg in die Antenne selber nimmt. Unmittelbar
nach Abgabe dieses Antennengefäßes nimmt die Seitenarterie durch zahlreiche Verzweigungen an der
Vascularisierung jenes oben erwähnten großmaschigen Bindegewebes zwischen Gehirn und Körperwand
teil. Aus diesem Gewirr von Gefäßsträngen tritt dann eines in die vordere Antenne ein. Ließ
sich auch seine Herkunft nicht mit Sicherheit feststellen, so ist doch wohl der Analogieschluß mit den
Verhältnissen bei den Decapoden erlaubt, daß es von der Seitenarterie abstammt.
Die A r t e r i a e h e p a t i c a e ( a . h., Fig. 1, 2, 3) nehmen ihren Ursprung dicht beieinander
median auf der Ventralseite des Herzens, nur unbedeutend von dessen Vorderrand entfernt. Beim
Männchen treten sie unmittelbar hinter der medianen Partie der vereinten Vasa deferentia (Fig. 62)
in die Tiefe, beim Weibchen hinter dem unpaaren Teile des Ovariums (Fig. 57). Sie ziehen schräg
nach vorn unten, dicht Seite an Seite geschmiegt. So treten sie median zwischen die Leberlappen
ein und bleiben in engster Berührung miteinander, bis sie in die Höhe des Darmes gelangen. Hier
entfernen sie sich voneinander, verlaufen zunächst eine kurze Strecke neben dem Darm, dann rechts
und links unterhalb des Darmes und etwas von ihm entfernt zwischen den Leberschläuchen nach vorn,
indem sie zahlreiche Äste abgeben. Dann, in der hinteren Magengegend, lösen sie sich in eine Anzahl
feinerer Gefäße auf, deren Schnitte man allenthalben zwischen den Leberschläuchen sieht.
Die Ar t e r i a e d e s c e n d e n t e s (a. d., Fig. 1, 2, 3, 4). Etwa senkrecht unter dem
Hinterrande der dorsalen schildförmigen Decke des Herzens entspringen auf einem kurzen, gemeinsamen
Truncus in der Medianen zwei Gefäße, die Arteriae descendentes, die im wesenthchen senkrecht
von oben nach unten verlaufen. Während aber das eine ein sehr starkes und voluminöses Rohr darstellt,
ist das andere nur außerordenthch schwach. Auch in seinem Verlauf zeigt es eine gewisse
Inkonstanz. Bei einigen Exemplaren Heß es sich schon nach ganz kurzem Verlauf nicht mehr verfolgen,
bei anderen wandte es sich als ein schmächtiger Gefäßstamm ein kleines Stück weit nach hinten.
Bei einem Männchen aber zeigte es einen sehr merkwürdigen Verlauf: es trat um die Vasa deferentia
und den Darm und vereinigte sich dann unterhalb des letzteren wieder mit dem starken Aste, zu dem
es genau symmetrisch verHef.
Der starke Ast steHt die Aorta descendens dar. Sie verläuft beim Männchen außen um das
Vas deferens, während sie beim jungen Weibchen um eine verschmälerte Stelle des Ovariums (Fig. 57)
herumtritt. Bei älteren Weibchen ist das Ovarium stark angeschwoUen, legt sich auch außen um die
Aorta herum und tritt hier wieder zusammen, so daß diese durch das Ovarium durchzutreten scheint.
Sie biegt weiterhin um den Darm und verläuft zwischen den beiden mächtigen Muskelzügen der
Flexoren des Abdomens, die noch in diese hintere Partie des Thorax eindringen, nach abwärts. In
der Nähe des Bauchmarkes teilt sich die Aorta in zwei hintereinander Hegende Stämme, von denen
der hintere sofort nochmals in zwei Gefäße hintereinander zerfäHt. Derartig entstehen drei Äste (Fig. 4).
Der vordere verläuft sehr schräg nach vorn, geht zwischen den Ganglien des 5. und 6. Cormopoden-
paares (d. h. zwischen dem 7. und 8. GängHenpaare) durch das Bauchmark und wird zur Sternal-
arterie. Der mittlere Stamm verläuft senkrecht hach unten, dürchdringt das Bauchmark zwischen
GangHen des 6. und 7. Cormopodenpaares, also zwischen dem 8. und 9. GangHenpaar und teilt sich
dann sofort in zwei nach rechts und links äbgehende Gefäße, die das sechste Cormopodenpaar versorgen.
Der hintere Ast verläuft zunächst fast wagrecht nach hinten und gibt einen dünnen, nach oben sich
wendenden Zweig ab, der median zwischen den beiden Partien der mächtigen Flexoren des Abdomens
in die Höhe steigt und sich in zwei Gefäße gabelt, die nach rechts und links hin auf der Dorsalseite
der Flexoren verlaufen (erster auf steigender Ast, ramus ascendens 1, r. a. 1, Fig. 4). ;— Der Stamm
selber wendet sich nun schräg nach unten zwischen die beiden Stränge des Bauchmarkes, gibt jedoch,
noch bevor er dieses durchdringt, einen zweiten, dünnen Ast ab, der schräg nach oben hinten verläuft,
sich teilt und die beiden Zweige rechts und links in die Muskelmassen des Flexors sendet (zweiter
aufsteigender Ast, ramus ascendens 2, r. a. 2, Fig. 4). Der dritte Aortenast durchdringt das Bauchmark
zwischen den GangHen der beiden letzten Cormopodenpäare, also dem 9. und 10. GangHenpaare,
und wird zur Abdominalarterie (a. a., Fig. 4).
Die Ar t e r i a s t e r n a l i s (a. st., Fig. 1, 4, 5). Die Sternalarterie gibt unmittelbar nach
dem Passieren des Bauchmarkes rechts und links einen Ast ab, der sich in den fünften Cormopoden
zieht. Die Arterie verläuft dann, dicht der Ventralseite des Bauchmarkes angeschmiegt, nach vorn
und entsendet in das vierte, dritte und zweite Cormopodenpaar Seitenäste. Nach der Abgabe der
Gefäße für die zweiten Cormopoden verläuft sie nur noch eine kurze Strecke als einheitlicher Stamm