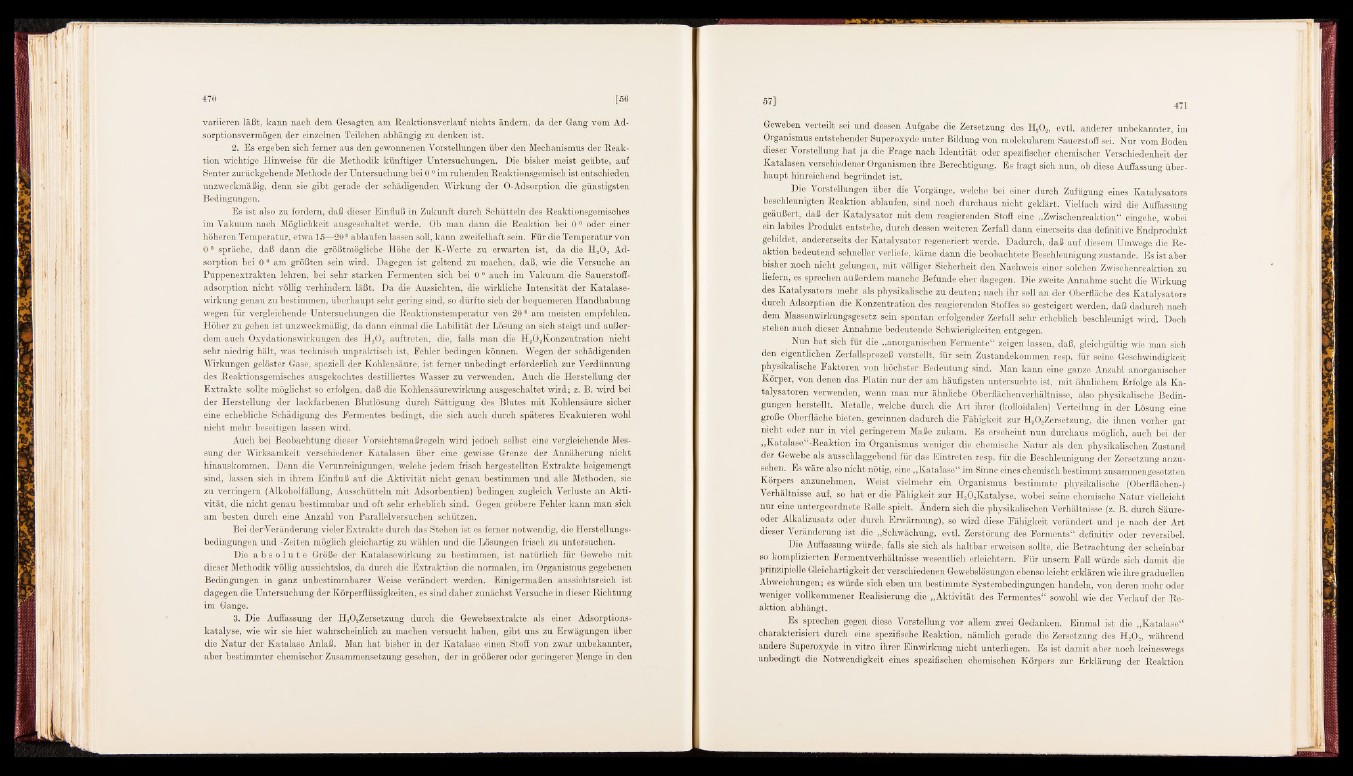
variieren läßt, kann nach dem Gesagten am Reaktionsverlauf nichts ändern, da der Gang vom Adsorptionsvermögen
der einzelnen Teilchen abhängig zu denken ist.
2. Es ergeben sich ferner aus den gewonnenen Vorstellungen über den Mechanismus der Reaktion
wichtige Hinweise für die Methodik künftiger Untersuchungen. Die bisher meist geübte, auf
Senter zurückgehende Methode der Untersuchung bei 0 0 im ruhenden Reaktionsgemisch ist entschieden
unzweckmäßig, denn sie gibt gerade der schädigenden Wirkung der O-Adsorption die günstigsten
Bedingungen.
Es ist also zu fordern, daß dieser Einfluß in Zukunft durch Schütteln des Reaktionsgemisches
im Vakuum nach Möglichkeit ausgeschaltet werde. Ob man dann die Reaktion bei 0 0 oder einer
höheren Temperatur, etwa 15—20° ablaufen lassen soll, kann zweifelhaft sein. Für die Temperatur von
0 0 spräche, daß dann die größtmögliche Höhe der K-Werte zu erwarten ist, da die H20 2 Adsorption
bei 0 0 am größten sein wird. Dagegen ist geltend zu machen, daß, wie die Versuche an
Puppenextrakten lehren, bei sehr starken Fermenten sich bei 0 0 auch im Vakuum die Sauerstoff-
adsorption nicht völlig verhindern läßt. Da die Aussichten, die wirkliche Intensität der Katalasewirkung
genau zu bestimmen, überhaupt sehr gering sind, so dürfte sich der bequemeren Handhabung
wegen für vergleichende Untersuchungen die Reaktionstemperatur von 20 0 am meisten empfehlen.
Höher zu gehen ist unzweckmäßig, da dann einmal die Labilität der Lösung an sich steigt und außerdem
auch Oxydationswirkungen des H20 2 auftreten, die, falls man die H20 2Konzentration nicht
sehr niedrig hält, was technisch unpraktisch ist, Fehler bedingen können. Wegen der schädigenden
Wirkungen gelöster Gase, speziell der Kohlensäure, ist ferner unbedingt erforderlich zur Verdünnung
des Reaktionsgemisches ausgekochtes destilliertes Wasser zu verwenden. Auch die Herstellung der
Extrakte sollte möglichst so erfolgen, daß die Kohlensäurewirkung ausgeschaltet wird; z. B. wird bei
der Herstellung der lackfarbenen Blutlösung durch Sättigung des Blutes mit Kohlensäure sicher
eine erhebliche Schädigung des Fermentes bedingt, die sich auch durch späteres Evakuieren wohl
nicht mehr beseitigen lassen wird.
Auch bei Beobachtung dieser Vorsichtsmaßregeln wird jedoch selbst eine vergleichende Messung
der Wirksamkeit verschiedener Katalasen über eine gewisse Grenze der Annäherung nicht
hinauskommen. Denn die Verunreinigungen, welche jedem frisch hergestellten Extrakte beigemengt
sind, lassen sich in ihrem Einfluß auf die Aktivität nicht genau bestimmen und alle Methoden, sie
zu verringern (Alkoholfällung, Ausschütteln mit Adsorbentien) bedingen zugleich Verluste an Aktivität,
die nicht genau bestimmbar und oft sehr erheblich sind. Gegen gröbere Fehler kann man sich
am besten durch eine Anzahl von Parallelversuchen schützen.
Bei der'Veränderung vieler Extrakte durch das Stehen ist es ferner notwendig, die Herstellungsbedingungen
und -Zeiten möglich gleichartig zu wählen und die Lösungen frisch zu untersuchen.
Die a b s o l u t e Größe der Katalasewirkung zu bestimmen, ist natürlich für Gewebe mit
dieser Methodik völlig aussichtslos, da durch die Extraktion die normalen, im Organismus gegebenen
Bedingungen in ganz unbestimmbarer Weise verändert werden. Einigermaßen aussichtsreich ist
dagegen die Untersuchung der Körperflüssigkeiten, es sind daher zunächst Versuche in dieser Richtung
im Gange.
3. Die Auffassung der H202Zersetzung durch die Gewebsextrakte als einer Adsorptionskatalyse,
wie wir sie hier wahrscheinlich zu machen versucht haben, gibt uns zu Erwägungen über
die Natur der Katalase Anlaß. Man hat bisher in der Katalase einen Stoff von zwar unbekannter,
aber bestimmter chemischer Zusammensetzung gesehen, der in größerer oder geringerer Menge in den
Geweben verteilt sei und dessen Aufgabe die Zersetzung des H202, evtl- anderer unbekannter, im
Organismus entstehender Superoxyde unter Bildung von molekularem Sauerstoff sei. Nur vom Boden
dieser Vorstellung hat ja die Frage nach Identität oder spezifischer chemischer Verschiedenheit der
Katalasen verschiedener Organismen ihre Berechtigung. Es fragt sich nun, ob diese Auffassung überhaupt
hinreichend begründet ist.
Die Vorstellungen über die Vorgänge, welche bei einer durch Zufügung eines Katalysators
beschleunigten Reaktion ablaufen, sind noch durchaus nicht geklärt. Vielfach wird die Auffassung
geäußert, daß der Katalysator mit dem reagierenden Stoff eine „Zwischenreaktion“ eingehe, wobei
ein labiles Produkt entstehe, durch dessen weiteren Zerfall dann einerseits das definitive Endprodukt
gebildet, andererseits der Katalysator regeneriert werde. Dadurch, daß auf diesem Umwege die Reaktion
bedeutend schneller verliefe, käme dann die beobachtete Beschleunigung zustande. Es ist aber
bisher noch nicht gelungen, mit völliger Sicherheit den Nachweis einer solchen Zwischenreaktion zu
liefern, es sprechen außerdem manche Befunde eher dagegen. Die zweite Annahme sucht die Wirkung
des Katalysators mehr als physikalische zu deuten; nach ihr soll an der Oberfläche des Katalysators
durch Adsorption die Konzentration des reagierenden Stoffes so gesteigert werden, daß dadurch nach
dem Massenwirkungsgesetz sein spontan erfolgender Zerfall sehr erheblich beschleunigt wird. Doch
stehen auch dieser Annahme bedeutende Schwierigkeiten entgegen.
Nun hat sich für die „anorganischen Fermente“ zeigen lassen, daß, gleichgültig wie man sich
den eigentlichen Zerfallsprozeß vorstellt, für sein Zustandekommen resp. für seine Geschwindigkeit
physikalische Faktoren von höchster Bedeutung sind. Man kann eine ganze Anzahl anorganischer
Körper, von denen das Platin nur der am häufigsten untersuchte ist, mit ähnlichem Erfolge als Katalysatoren
verwenden, wenn man nur ähnliche Oberflächenverhältnisse, also physikalische Bedingungen
herstellt. Metalle, welche durch die Art ihrer (kolloidalen) Verteilung in der Lösung eine
große Oberfläche bieten, gewinnen dadurch die Fähigkeit zur H202Zersetzung, die ihnen vorher gar
nicht oder nur in viel geringerem Maße zukam. Es erscheint nun durchaus möglich, auch bei der
„Katalase“-Reaktion im Organismus weniger die chemische Natur als den physikalischen Zustand
der Gewebe als ausschlaggebend für das Eintreten resp. für die Beschleunigung der Zersetzung anzusehen.
Es wäre also nicht nötig, eine „Katalase“ im Sinne eines chemisch bestimmt zusammengesetzten
Körpers anzunehmen. Weist vielmehr ein Organismus bestimmte physikalische (Oberflächen-)
Verhältnisse auf, so hat er die Fähigkeit zur H202Katalyse, wobei seine chemische Natur vielleicht
nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ändern sich die physikalischen Verhältnisse (z. B. durch Säureoder
Alkalizusatz oder durch Erwärmung), so wird diese Fähigkeit verändert und je nach der Art
dieser .Veränderung ist die „Schwächung, evtl. Zerstörung des Ferments“ definitiv oder reversibel.
Die Auffassung würde, falls sie sich als haltbar erweisen sollte, die Betrachtung der scheinbar
so komplizierten Fermentverhältnisse wesentlich erleichtern. Für unsern Fall würde sich damit die
prinzipielle Gleichartigkeit der verschiedenen Gewebslösungen ebenso leicht erklären wie ihre graduellen
Abweichungen; es würde sich eben um bestimmte Systembedingungen handeln, von deren mehr oder
weniger vollkommener Realisierung die „Aktivität des Fermentes“ sowohl wie der Verlauf der Reaktion
abhängt.
Es sprechen gegen diese Vorstellung vor allem zwei Gedanken. Einmal ist die „Katalase“
charakterisiert durch eine spezifische Reaktion, nämlich gerade die Zersetzung des H20 2, während
andere Superoxyde in vitro ihrer Einwirkung nicht unterliegen. Es ist damit aber noch keineswegs
unbedingt die Notwendigkeit eines spezifischen chemischen Körpers zur Erklärung der Reaktion