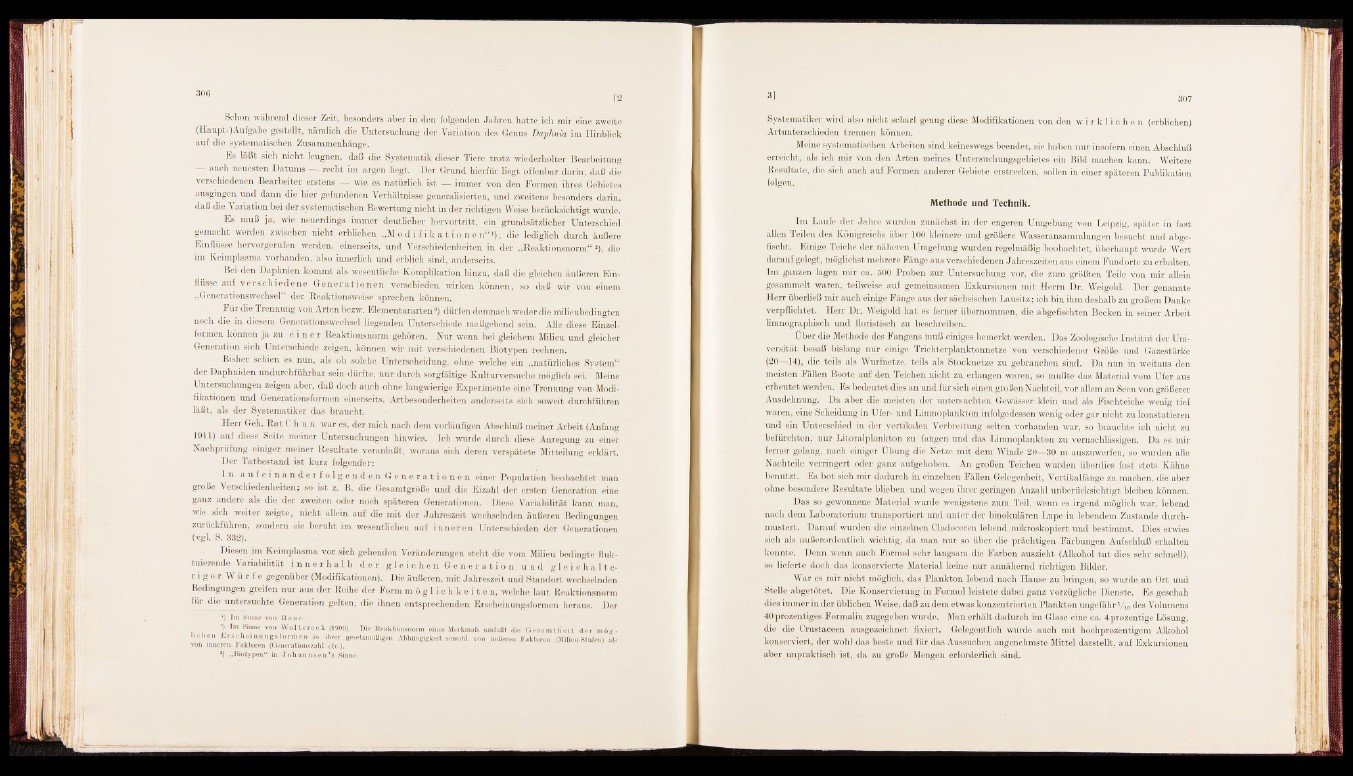
Schon während dieser Zeit, besonders aber in den folgenden Jahren hatte ich mir eine zweite
(Haupt-)Aufgabe gestellt, nämlich die Untersuchung der Variation des Genus Daphnia im Hinblick
auf die systematischen Zusammenhänge.
Es läßt sich nicht leugnen, daß die Systematik dieser Tiere trotz wiederholter Bearbeitung
| aucl1 neuesten Datums — recht im argen liegt. Der Grund hierfür liegt offenbar darin, daß die
verschiedenen Bearbeiter erstens — wie es natürlich ist — immer von den Formen ihres Gebietes
ausgingen und dann die hier gefundenen Verhältnisse generalisierten, und zweitens besonders darin,
daß die Variation bei der systematischen Bewertung nicht in der richtigen Weise berücksichtigt wurde.
Es muß ja, wie neuerdings immer deutlicher hervortritt, ein grundsätzlicher Unterschied
gemacht werden zwischen nicht erblichen „ M o d i f i k a t i o n e n “1), die lediglich durch äußere
Einflüsse hervorgerufen werden, einerseits, und Verschiedenheiten in der „Beaktionsnorm“ 2), die
im Keimplasma vorhanden, also innerlich und erblich sind, anderseits.
Bei den Daphnien kommt als wesentliche Komplikation hinzu, daß die gleichen äußeren Einflüsse
auf v e r s c h i e d e n e G e n e r a t i o n e n verschieden wirken können, so daß wir von einem
„Generationswechsel“ der Beaktionsweise sprechen können.
Für die Trennung von Arten bezw. Elementararten3) dürfen demnach weder die milieubedingten
noch die in diesem Generationswechsel hegenden Unterschiede maßgebend sein. Alle diese Einzelformen
können ja zu e i n e r Beaktionsnorm gehören. Nur wenn bei gleichem Milieu und gleicher
Generation sich Unterschiede zeigen, können wir mit verschiedenen Biotypen rechnen.
Bisher schien es nun, als ob solche Unterscheidung, ohne welche ein „natürliches System“
der Daphmden undurchführbar sein dürfte, nur durch sorgfältige Kulturversuche möglich sei. Meine
Untersuchungen zeigen aber, daß doch auch ohne langwierige Experimente eine Trennung von Modifikationen
und Generationsformen einerseits, Artbesonderheiten anderseits sich soweit durchführen
läßt, als der Systematiker das braucht.
Herr Geh. Bat C h u n war es, der mich nach dem vorläufigen Abschluß meiner Arbeit (Anfang
1911) auf diese Seite meiner Untersuchungen hinwies. Ich wurde durch diese Anregung zu einer
Nachprüfung einiger meiner Besultate veranlaßt, woraus sich deren verspätete Mitteilung erklärt.
Der Tatbestand ist kurz folgender:
I n a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n G e n e r a t i o n e n einer Population beobachtet man
große Verschiedenheiten; so ist z. B. die Gesamtgröße und die Eizahl der ersten Generation eine
ganz andere als die der zweiten oder noch späteren Generationen. Diese Variabilität kann man,
wie sich weiter zeigte, nicht allein auf die mit der Jahreszeit wechselnden äußeren Bedingungen
zurückführen, sondern sie beruht im wesentlichen auf inneren Unterschieden der Generationen
(vgl. S. 332).
Diesen im Keimplasma vor sieh gehenden Veränderungen steht die vom Milieu bedingte fluktuierende
Variabilität i n n e r h a l b de r g l e i c h e n Ge n e r a t i o n u nd g l e i c h a l t e -
r i g e r Wü r f e gegenüber (Modifikationen). Die äußeren, mit Jahreszeit und Standort wechselnden
Bedingungen greifen nur aus der Beihe der Form m ö g l i c h k e i t e n , welche laut Beaktionsnorm
für die untersuchte Generation gelten, die ihnen entsprechenden Erscheinungsformen heraus. Der
1 Im S in n e v o n B a u r .
*) Sin n e v o n W o l t e r e c k (1909). D ie Reaktionsnorm eines M e rkma ls um f a ß t die G e s a m t tí e i t d e r m ö g -
l i e h e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n in ih re r g e se tzmäßigen A b h än g ig k e it sowohl v o n äuß e ren F a k to r e n (Milieu-Stufen) als
v o n in n e ren F a k to r e n (G ene ra tionsz ahl etc .).
*) „Biotypen“ in Johannsen’s Sinne.
Systematiker wird also nicht scharf genug diese Modifikationen von den w i r k l i c h e n (erblichen)
Artunterschieden trennen können.
Meine systematischen Arbeiten sind keineswegs beendet, sie haben nur insofern einen Abschluß
erreicht, als ich mir von den Arten meines Untersuchungsgebietes ein Bild machen kann. Weitere
Besultate, die sich auch auf Formen anderer Gebiete erstrecken, sollen in einer späteren Publikation
folgen..
Methode und Technik.
Im Laufe der Jahre wurden zunächst in. der engeren Umgebung von Leipzig, später in fast
allen Teilen des Königreichs über 100 kleinere und größere Wasseransammlungen besucht und abgefischt.
Einige Teiche der näheren Umgebung wurden regelmäßig beobachtet, überhaupt wurde Wert
darauf gelegt, möglichst mehrere Fänge aus verschiedenen Jahreszeiten aus einem Fundorte zu erhalten.
Im ganzen lagen mir ca. 500 Proben zur Untersuchung vor, die zum größten Teile von mir allein
gesammelt waren, teilweise auf gemeinsamen Exkursionen mit Herrn Dr. Weigold. Der genannte
Herr überließ mir auch einige Fänge aus der sächsischen Lausitz; ich bin ihm deshalb zu großem Danke
verpflichtet. Herr Dr. Weigold hat es ferner übernommen, die abgefischten Becken in seiner Arbeit
limnographisch und floristisch zu beschreiben.
Uber die Methode des Fangens muß einiges bemerkt werden. Das Zoologische Institut der Universität
besaß bislang nur einige Trichterplanktonnetze von- verschiedener Größe und Gazestärke
(20—14), die teils als Wurfnetze, teils als Stocknetze zu gebrauchen sind. Da nun in weitaus den
meisten Fällen Boote auf den Teichen nicht zu erlangen waren, so mußte das Material vom Ufer aus
erbeutet werden. Es bedeutet dies an und für sich einen großen Nachteil, vor allem an Seen von größerer
Ausdehnung. Da aber die meisten der untersuchten Gewässer klein und als Fischteiche wenig tief
waren, eine Scheidung in Ufer- und Limnoplankton infolgedessen wenig oder gar nicht zu konstatieren
und ein Unterschied in der vertikalen Verbreitung selten vorhanden war, so brauchte ich nicht zu
befürchten, nur Litoralplankton zu fangen und das Limnoplankton zu vernachlässigen. Da es mir
ferner gelang, nach einiger Übung die Netze mit dem Winde 20—30 m auszuwerfen, so wurden alle
Nachteile verringert oder ganz aufgehoben. An großen Teichen wurden überdies fast stets Kähne
benutzt. Es bot sich mir dadurch in einzelnen Fällen Gelegenheit, Vertikalfänge zu machen, die aber
ohne besondere Besultate blieben und wegen ihrer geringen Anzahl unberücksichtigt bleiben können.
Das so gewonnene Material wurde wenigstens zum Teil, wenn es irgend möglich war, lebend
nach dem Laboratorium transportiert und unter der binokulären Lupe in lebendem Zustande durchmustert.
Darauf wurden die einzelnen Cladoceren lebend mikroskopiert und bestimmt. Dies erwies
sich als außerordentlich wichtig, da man nur so über die prächtigen Färbungen Aufschluß erhalten
konnte. Denn wenn auch Formol sehr langsam die Farben auszieht (Alkohol tu t dies sehr schnell),
so lieferte doch das konservierte Material keine nur annähernd richtigen Bilder.
War es mir nicht möglich, das Plankton lebend nach Hause zu bringen, so wurde an Ort und
Stelle abgetötet. Die Konservierung in Formol leistete dabei ganz vorzügliche Dienste. Es geschah
dies immer in der üblichen Weise, daß zu dem etwas konzentrierten Plankton ungefähr y10 des Volumens
40prozentiges Formalin zugegeben wurde. Man erhält dadurch im Glase eine ca. 4prozentige Lösung,
die die Crustaceen ausgezeichnet fixiert. Gelegentlich wurde auch mit hochprozentigem Alkohol
konserviert, der wohl das beste und für das Aussuchen angenehmste Mittel darstellt, auf Exkursionen
aber unpraktisch ist, da zu große Mengen erforderlich sind.