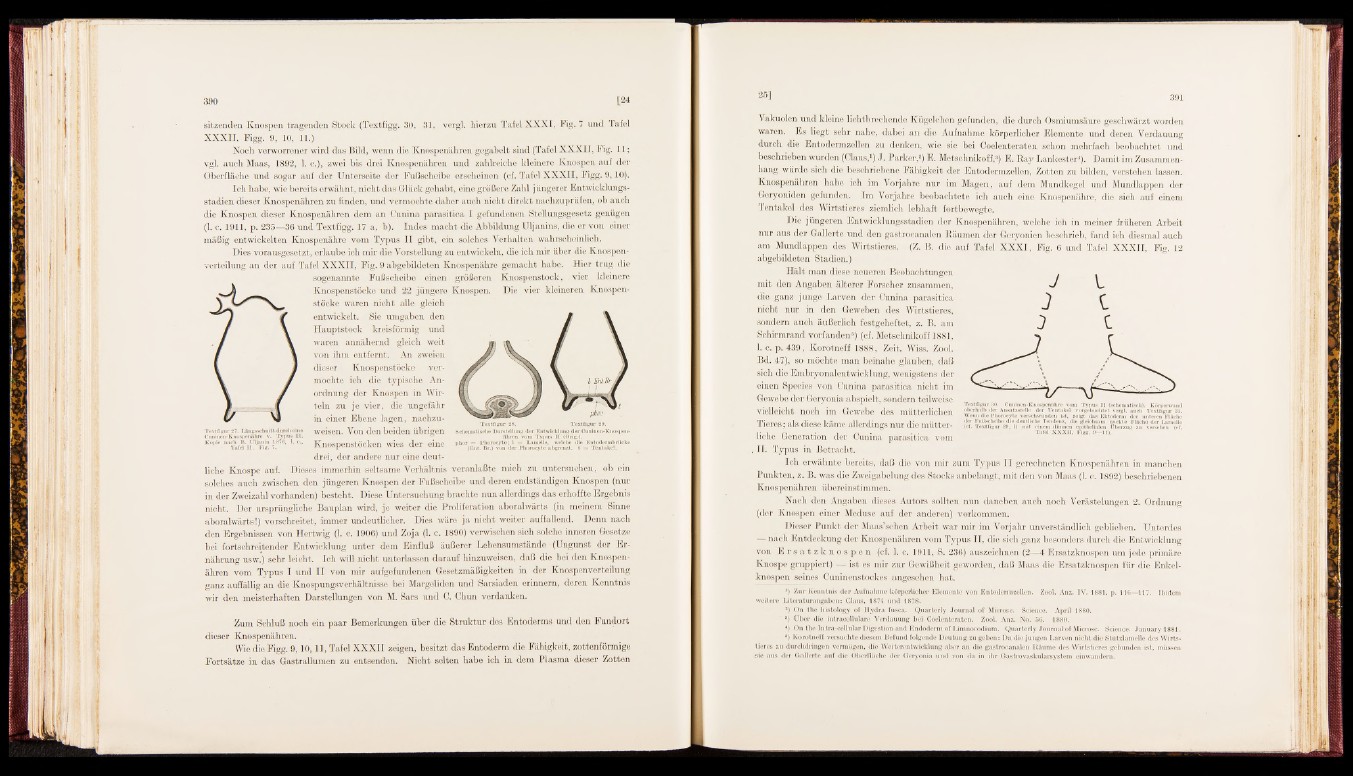
, 30, 31, vergl. hierzu sitzenden Knospen tragenden Stock (Textfij_ Tafel XXXI, Fit und Tafel
XXXII, Figg. 9, 10, 11.)
Noch verworrener wird das Bild, wenn die Knospenähren gegabelt sind (Tafel XXXII, Fig. 11;
vgl. auch Maas, 1892, 1. c.), zwei bis drei Knospenähren und zahlreiche kleinere Knospen auf der
Oberfläche und sogar auf der Unterseite der Fußscheibe erscheinen (cf. Tafel XXXII, Figg. 9,10).
Ich habe, wie bereits erwähnt, nicht das Glück gehabt, eine größere Zahl jüngerer Entwicklungsstadien
dieser Knospenähren zu finden, und vermochte daher auch nicht direkt nachzuprüfen, ob auch
die Knospen dieser Knospenähren dem an Cunina parasitica I gefundenen Stellungsgesetz genügen
(1. c. 1911, p. 235—36 und Textfigg. 17 a, b). Indes macht die Abbildung Uljanins, die er von einer
mäßig entwickelten Knospenähre vom Typus II gibt, ein solches Verhalten wahrscheinlich.
Dies vorausgesetzt, erlaube ich mir die Vorstellung zu entwickeln, die ich mir über die Knospenverteilung
an der auf Tafel XXXII, Fig. 9 abgebildeten Knospenähre gemacht habe. Hier trug die
sogenannte Fußscheibe einen größeren Knospenstock, vier kleinere
Knospenstöcke und 22 jüngere Knospen. Die vier kleineren Knospenstöcke
waren nicht alle gleich
entwickelt. Sie umgaben den
Hauptstock kreisförmig und
waren annähernd gleich weit
von ihm entfernt. An zweien
dieser Knospenstöcke vermochte
ich die typische Anordnung
der Knospen in Wirteln
zu je vier, die ungefähr
in einer Ebene lagen, nachzuweisen.
Von den beiden übrigen
Knospenstöcken wies der eine
drei, der andere nur eine deutliche
Textfigur 27. Längsschnitt durch eine
Cu 11 inen-KnospeiiiUi re v. Typus II.
Kopie nach B. Uljaiiin 1876, 1. c.:
• Tafel II. TTig. 7.
Textfigur 28: Textfigur 29.
SclicnuvUscho Darstellung der Entwicklung der Cuniuoii-lCnospen-
fthren vom Typus I I (Orig.),
phor = Phorocyte; 1 = Lamelle, wolcho die Entodcrrabrilcke
(Ent. Br.) von der Phorocyte abgrenzt, t = Tentakel.
Knospe auf. Dieses immerhin seltsame Verhältnis veranlaßte mich zu untersuchen, ob ein
solches auch zwischen den jüngeren Knospen der Fußscheibe und deren endständigen Knospen (nur
in der Zweizahl vorhanden) besteht. Diese Untersuchung brachte nun allerdings das erhoffte Ergebnis
nicht. Der ursprüngliche Bauplan wird, je weiter die Proliferation aboralwärts (in meinem Sinne
aboralwärts!) vorschreitet, immer undeutlicher. Dies wäre ja nicht weiter auffallend. Denn nach
den Ergebnissen von Hertwig (1. c. 1906) und Zoja (1. c. 1890) verwischen sich solche inneren Gesetze
bei fortschreitender Entwicklung unter dem Einfluß äußerer Lebensumstände (Ungunst der Ernährung
usw.) sehr leicht. Ich will nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß die bei den Knospenähren
vom Typus I und II von mir aufgefundenen Gesetzmäßigkeiten in der Knospenverteilung
ganz auffällig an die Knospungsverhältnisse bei Margeliden und Sarsiaden erinnern, deren Kenntnis
wir den meisterhaften Darstellungen von M. Sars und C. Chun verdanken.
Zum Schluß noch ein paar Bemerkungen über die Struktur des Entoderms und den Fundort
dieser Knospenähren.
Wie die Figg. 9,10,11, Tafel XXXII zeigen, besitzt dasEntoderm die Fähigkeit, zottenförmige
Fortsätze in das Gastrallumen zu entsenden. Nicht selten habe ich in dem Plasma dieser Zotten
Vakuolen und kleine lichtbrechende Kügelchen gefunden, die durch Osmiumsäure geschwärzt worden
waren. Es liegt sehr nahe, dabei an die Aufnahme körperlicher Elemente und deren Verdauung
durch die Entodermzellen zu denken, wie sie bei Coelenteraten schon mehrfach beobachtet und
beschrieben wurden (Claus,1) J. Parker,2) E. Metschnikoff,3) E. Ray Lankester4). Damit im Zusammenhang
würde sich die beschriebene Fähigkeit der Entodermzellen, Zotten zu bilden, verstehen lassen.
Knospenähren habe ich im Vorjahre nur im Magen, auf dem Mundkegel und Mundlappen der
Geryoniden gefunden. Im Vorjahre beobachtete ich auch eine Knospenähre, die sich auf einem
Tentakel des Wirtstieres ziemlich lebhaft fortbewegte.
Die jüngeren Entwicklungsstadien der Knospenähren, welche ich in meiner früheren Arbeit
nur aus der Gallerte und den gastrocanalen Räumen der Geryonien beschrieb, fand ich diesmal auch
am Mundläppen des Wirtstieres. (Z. B. die auf Tafel XXXI, Fig. 6 und Tafel XXXII, Fig. 12
abgebildeten Stadien.)
Hält man diese neueren Beobachtungen
mit den Angaben älterer Forscher zusammen,
die ganz junge Larven der Cunina parasitica
nicht nur in den Geweben des Wirtstieres,
sondern auch äußerlich festgeheftet, z. B. am
Schirmrand vorfanden6) (cf. Metschnikoff 1881,
1. c. p. 439, Korotneff 1888 , Zeit. Wiss. Zool.
Bd. 47), so möchte man beinahe glauben, daß
sich die Embryonalentwicklung, wenigstens der
einen Species von Cunina parasitica nicht im
Gewebe der Geryonia abspielt, sondern teilweise
vielleicht noch im Gewebe des mütterlichen
Tieres; als diese käme allerdings nur die mütterliche
Generation der Cunina parasitica vom
, II. Typus in Betracht.
Ich erwähnte bereits, daß die von mir zum Typus II gerechneten Knospenähren in manchen
Punkten, z. B. was die Zweigabelung des Stocks anbelangt, mit den von Maas (1. c. 1892) beschriebenen
Knospenähren übereinstimmen.
Nach den Angaben dieses Autors sollten nun daneben auch noch Verästelungen 2. Ordnung
(der Knospen einer Meduse auf der anderen) Vorkommen.
Dieser Punkt der Maas’sclien Arbeit war mir im Vorjahr unverständlich geblieben. Unterdes
— nach Entdeckung der Knospenähren vom Typus II, die sich ganz besonders durch die Entwicklung
von E r s a t z k n o s p e n (cf. 1. c. 1911, S. 236) auszeichnen (2—4 Ersatzknospen um jede primäre
Knospe gruppiert) — ist es mir zur Gewißheit geworden, daß Maas die Ersatzknospen für die Enkelknospen
seines Cuninenstockes angesehen hat.
') Z u r K en n tn is d e r AuFnahme körp e rlich e r E lem en te v o n Ento d e rm z e llen . Zool. Anz. IV. 1881, p. 116—117. Ibidem
we ite re L ite ra tu ra n g a b o n : Claus, 1874 u n d 1878.
*) O n th e h is to lo g y o f H y d r a fusc a . Q u a rte rly J o u rn a l oF Microsc. Science. April 1880.
®) Ü b e r die in tra c e llu la re V e rd au u n g bei C o e len te ra ten . Zool. Anz. No. 56. 1880.
4) On th e In tra -c e llu la r D ige stion a n d E n d o d e rm oF L imnocodium. Q u a rte rly J o u rn a l oF M icrosc. Science. J a n u a ry 1881.
®) KorotneFF v e rsu ch te diesem BeFund Folgende D eu tu n g zu geb en : D a die ju n g en L a rv en n ic h t die S tü tz lam e lle de s W ir ts tie
re s zu d u rch d rin g en vermögen, die W e ite ren tw ick lu n g a b e r a n die g a stro c an a len R äum e de s W irts tie re s geb u n d en is t, müssen
sie au s d e r G a lle rte a u f die OberFläche d e r Ge ryonia u n d von d a in ih r G a s tro v a sk u la rsy s tem einwandern.