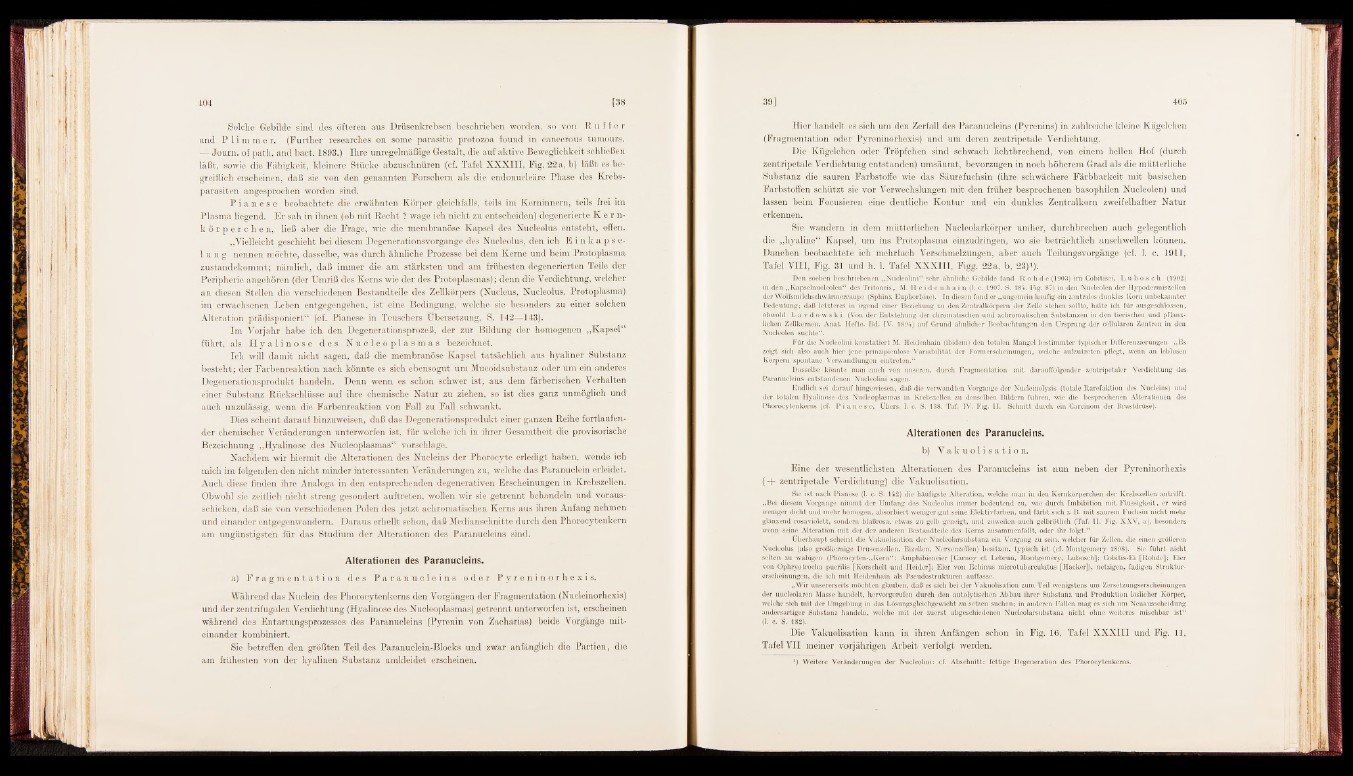
Solche Gebilde sind des öfteren aus Drüsenkrebsen beschrieben worden, so von R u f f e r
und P 1 i m m e r. (Further researches on some parasitic protozoa found in cancerous tumours.
— Journ. of path. and bact. 1893.) Ihre unregelmäßige Gestalt, die auf aktive Beweglichkeit schließen
läßt, sowie die Fähigkeit, kleinere Stücke abzuschnüren (cf. Tafel XXXIII, Fig. 22 a, b) läßt es begreiflich
erscheinen, daß sie von den genannten Forschern als die endonucleäre Phase des Krebsparasiten
angesprochen worden sind.
P i a n e s e beobachtete die erwähnten Körper gleichfalls, teils im Kerninnern, teils frei im
Plasma liegend. Er sah in ihnen (ob mit Recht ? wage ich nicht zu entscheiden) degenerierte Ke r n k
ö r p e r c h e n , ließ aber die Frage, wie die membranöse Kapsel des Nucleolus entsteht, offen.
„Vielleicht geschieht bei diesem Degenerationsvorgange des Nucleolus, den ich E i n k a p s e-
1 u n g nennen möchte, dasselbe, was durch ähnliche Prozesse bei dem Kerne und beim Protoplasma
zustandekommt; nämlich, daß immer die am stärksten und am frühesten degenerierten Teile der
Peripherie angehören (der Umriß des Kerns wie der des Protoplasmas); denn die Verdichtung, welcher
an diesen Stellen die verschiedenen Bestandteile des Zellkörpers (Nucleus, Nucleolus, Protoplasma)
im erwachsenen Leben entgegengehen, ist eine Bedingung, welche sie besonders zu einer solchen
Alteration prädisponiert“ (cf. Pianese- in Teuschers Übersetzung, S. 142—143).
Im Vorjahr habe ich den Degenerationsprozeß, der zur Bildung der homogenen „Kapsel“
führt, als Hy a l i n o s e des Nu c l e o p l a sma s bezeichnet.
Ich will damit nicht sagen, daß die membranöse Kapsel tatsächlich aus hyaliner Substanz
besteht; der Farbenreaktion nach könnte es sich ebensogut um Mucoidsubstanz oder um ein anderes
Degenerationsprodukt handeln. Denn wenn es schon schwer ist, aus dem färberischen Verhalten
einer Substanz Rückschlüsse auf ihre chemische Natur zu ziehen, so ist dies ganz unmöglich und
auch unzulässig, wenn die Farbenreaktion von Fall zu Fall schwankt.
Dies scheint, darauf hinzuweisen, daß das Degenerationsprodukt einer ganzen Reihe fortlaufender
chemischer Veränderungen unterworfen ist, für welche ich in ihrer Gesamtheit die provisorische
Bezeichnung „Hyalinose des Nucleoplasmas“ vorschlage.
Nachdem wir hiermit die Alterationen des Nucleins der Phorocyte erledigt haben, wende ich
mich im folgenden den nicht minder interessanten Veränderungen zu, welche das Paranuclein erleidet.
Auch diese finden ihre Analoga in den entsprechenden degenerativen Erscheinungen in Krebszellen.
Obwohl sie zeitlich nicht streng gesondert auftreten, wollen wir sie getrennt behandeln und vorausschicken,
daß sie von verschiedenen Polen des jetzt achromatischen Kerns aus ihren Anfang nehmen
und einander entgegenwandem. Daraus erhellt schon, daß Medianschnitte durch den Phorocytenkern
am ungünstigsten für das Studium der Alterationen des Paranucleins sind.
Alterationen des Paranucleins.
a) F r a gm e n t a t i o n des P a r a n u c l e i n s ode r P y r e n i n o r h e x i s .
Während das Nuclein des Phorocytenkerns den Vorgängen der Fragmentation (Nucleinorhexis)
und der zentrifugalen Verdichtung (Hyalinose des Nucleoplasmas) getrennt unterworfen ist, erscheinen
während des Entartungsprozesses des Paranucleins (Pyrenin von Zacharias) beide Vorgänge miteinander
kombiniert.
Sie betreffen den größten Teil des Paranuclein-Blocks und zwar anfänglich die Partien, die
am frühesten von der hyalinen Substanz umkleidet erscheinen.
Hier handelt es sich um den Zerfall des Paranucleins (Pyrenins) in zahlreiche kleine Kügelchen
(Fragmentation oder Pyreninorhexis) und um deren zentripetale Verdichtung.
Die Kügelchen oder Tröpfchen sind schwach lichtbrechend, von einem hellen Hof (durch
zentripetale Verdichtung entstanden) umsäumt, bevorzugen in noch höherem Grad als die mütterliche
Substanz die sauren Farbstoffe wie das Säurefuchsin (ihre schwächere Färbbarkeit mit basischen
Farbstoffen schützt sie vor Verwechslungen mit den früher besprochenen basophilen Nucleolen) und
lassen beim Focusieren eine deutliche Kontur und ein dunkles Zentralkorn zweifelhafter Natur
erkennen.
Sie wandern in dem mütterlichen Nucleolarkörper umher, durchbrechen auch gelegentlich
die ;,hyaline“ Kapsel, um ins Protoplasma einzudringen, wo sie beträchtlich anschwellen können.
Daneben beobachtete ich mehrfach Verschmelzungen, aber auch Teilungsvorgänge (cf. 1. c. 1911,
Tafel VIII, Fig. 31 und h. 1. Tafel XXXIII, Figg. 22 a, b, 23)x).
Den soeben beschriebenen „Nucleolini“ sehr ähnliche Gebilde fand R o h d e (1903) im Gobitisei, L u b o s c h (1902)
in den „Kapselnucleolen“ des Tritoneis, M. H e i d e n h a i n (1. c. 1907. S. 184. Fig. 87) in den Nucleolen der Hypodermiszellen
der W olfsmilchschwärmerraupe (Sphinx Euphorbiae). In diesen fand er „ungemein häufig ein zentrales dunkles Korn unbekannter
Bedeutung; daß letzteres in irgend einer Beziehung zu den Zentralkörpern der Zelle stehen sollte, halte ich für ausgeschlossen,
obwohl L a v d o w s k i (Von der Entstehung der chromatischen und achromatischen Substanzen.in den tierischen und pflanzlichen
Zellkernen, Anat. Hefte. Bd. IV. 1894) auf Grund ähnlicher Beobachtungen den Ursprung der cellulären Zentren in den
Nucleolen suchte“ .
Für die Nucleolini konstatiert M. Heidenhain (ibidem) den totalen Mangel bestimmter typischer Differenzierungen. „E s
zeigt sich also auch hier jene prinzipienlose Variabilität der Formerscheinungen, welche aufzutreten pflegt, wenn an leblosen
Körpern spontane Verwandlungen eintreten.“
Dasselbe könnte man auch von unseren, durch Fragmentation m it darauffolgender zentripetaler Verdichtung des
Paranucleins entstandenen Nucleolini sagen.
Endlich sei darauf hingewiesen, daß die verwandten Vorgänge der Nucleinolysis (totale Rarefaktion des Nucleins) und
der totalen Hyalinose des Nucleoplasmas in Krebszellen zu denselben Bildern führen, wie die besprochenen Alterationen des
Phorocytenkerns (cf. P i a n e s e , Übers. 1. c. S. 138. Taf. IV. Fig. II. Schnitt durch ein Garcinom der Brustdrüse).
Alterationen des Paranucleins.
b) V a ku o l i s a t i o n .
Eine der wesentlichsten Alterationen des Paranucleins ist nun neben der Pyreninorhexis
(+ zentripetale Verdichtung) die Vakuolisation.
Sie ist nach Pianese (1. c. S. 142) die häufigste Alteration, welche man in den Kernkörperchen der Krebszellen antrifft.
„Be i diesem Vorgänge nimmt der Umfang des Nucleolus immer bedeutend zu, wie durch Imbibition m it F lüssigke it, er wird
weniger dicht und mehr homogen, absorbiert weniger gu t seine Elektivfarben, und färbt sich z. B. m it saurem Fuchsin n ich t mehr
glänzend rosaviolett, sondern blaßrosa, etwas zu gelb geneigt, und zuweilen auch gelbrötlich (Taf. II. Fig. XX V , a), besonders
wenn seine Alteration m it der. der anderen Bestandteile des Kerns zusammenfällt, oder ihr folgt.“
Überhaupt scheint die Vakuolisation der Nucleolarsubstanz ein Vorgang zu sein, welcher für Zellen, die einen größeren
Nucleolus (also großkernige Drüsenzellen, Eizellen, Nervenzellen) besitzen, typisch is t (cf. Montgomery 1898). Sie führt nicht
selten zu wabigen (Phorocyten-„Kern“ ; Amphibieneier [Garnoy e t Lebrun, Montgomery, Lubosch]; Cobitis-Ei [Rohde]; Eier
von Ophryotrocha puerilis [Korschelt und I-Ieider]; Eier von Echinus microtuberculatus [Häcker]), netzigen, fädigen Strukturerscheinungen,
die ich m it Heidenhain als Pseudostrukturen auffasse.
„Wir unsererseits möchten glauben, daß es sich bei der Vakuolisation zum Teil wenigstens um Zersetzungserscheinungen
der nucleolaren Masse handelt, hervorgerufen durch den autolytischen Abbau ihrer Substanz und Produktion löslicher Körper,
welche sich m it der Umgebung in das Lösungsgleichgewicht zu setzen suchen; in anderen Fällen mag es sich um Neuausscheidung
andersartiger Substanz handeln, welche m it der zuerst abgeschiedenen Nucleolarsubstanz nicht ohne weiteres mischbar is t“
(1. c. S. 182). '
Die Vakuolisation kann in ihren Anfängen schon in Fig. 16, Tafel XXXIII und Fig. 11,
Tafel VII meiner vorjährigen Arbeit verfolgt werden.
*) Weitere Veränderungen der Nucleolini: cf. Abschnitt: fettige Degeneration des Phorocytenkerns.