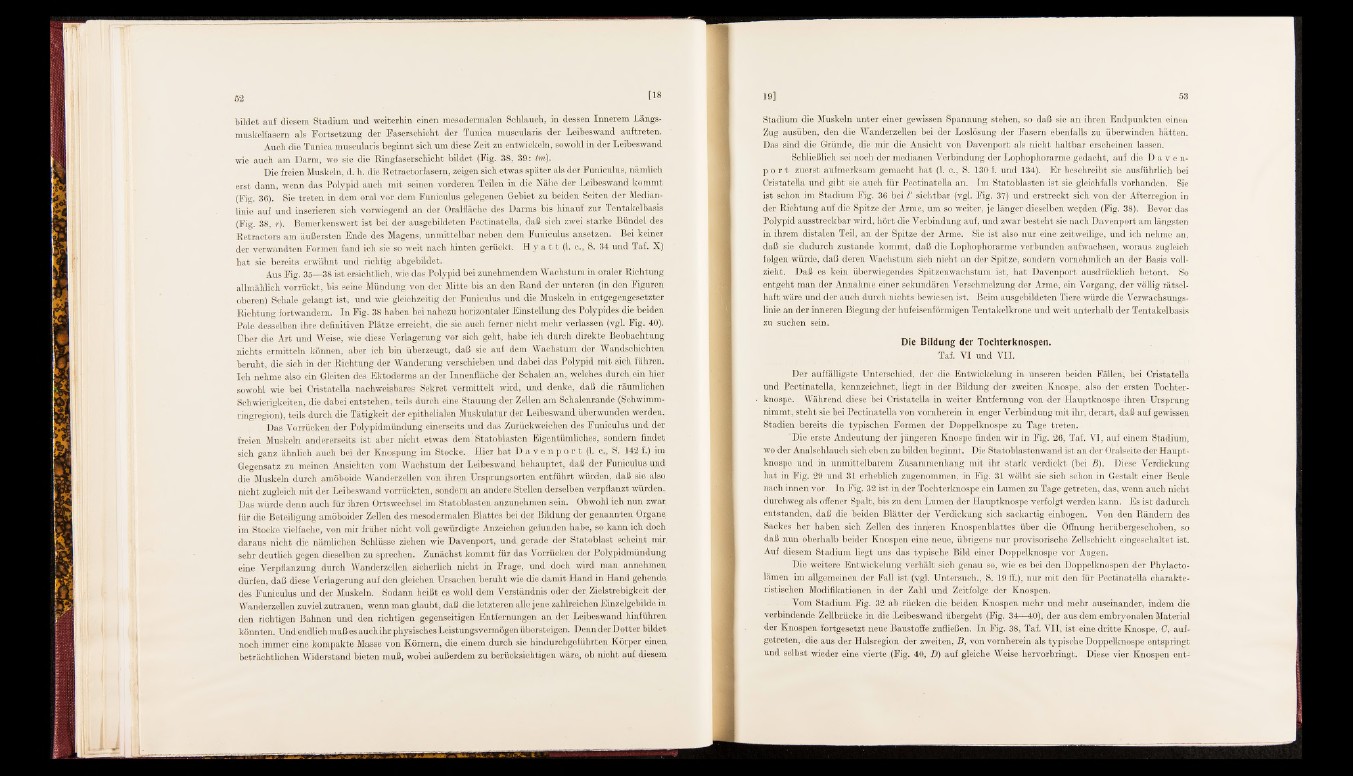
bildet auf diesem Stadium und weiterbin einen mesodermalen Schlauch, in dessen Innerem Längs-
muskelfasem als Fortsetzung der Faserschicht der Tunica muscularis der Leibeswand auftreten.
Aucb die Tunica muscularis beginnt sieb um diese Zeit zu entwickeln, sowohl in der Leibeswand
wie aucb am Darm, wo sie die Ringfaserschicht bildet (Fig. 38, 39: tm).
Die freien Muskeln, d. b. die Retractorfasern, zeigen sich etwas später als der Funiculus, nämlich
erst dann, wenn das Polypid aucb mit seinen vorderen Teilen in die Nähe der Leibeswand kommt
(Fig. 36). Sie treten in dem oral vor dem Funiculus gelegenen Gebiet zu beiden Seiten der Medianlinie
auf und inserieren sich vorwiegend an der Oralfläche des Darms bis hinauf zur Tentakelbasis
(Fig. 38, r). Bemerkenswert ist bei der ausgebildeten Pectinatella, daß sich zwei starke Bündel des
Retractors am äußersten Ende des Magens, unmittelbar neben dem Funiculus ansetzen. Bei keiner
der verwandten Formen fand ich sie so weit nach hinten gerückt. H y a 11 (1. c., S. 34 und Taf. X)
hat sie bereits erwähnt und richtig abgebildet..
Aus Fig. 35—38 ist ersichtlich, wie das Polypid bei zunehmendem Wachstum in oraler Richtung
allmählich vorrückt, bis seine Mündung von der Mitte bis an den Rand der unteren (in den Figuren
oberen) Schale gelangt ist, und wie gleichzeitig der Funiculus und die Muskeln in entgegengesetzter
Richtung fortwandern. In Fig. 38 haben bei nahezu horizontaler Einstellung des Polypides die beiden
Pole desselben ihre definitiven Plätze erreicht, die sie auch ferner nicht mehr verlassen (vgl. Fig. 40).
Über die Art und Weise, wie diese Verlagerung vor sich geht, habe ich durch direkte Beobachtung
nichts ermitteln können, aber ich bin überzeugt, daß sie auf dem Wachstum der Wandschichten
beruht, die sich in der Richtung der Wanderung verschieben und dabei das Polypid mit sich führen.
Ich nehme also ein Gleiten des Ektoderms an der Innenfläche der Schalen, an, welches durch ein hier
sowohl wie bei Cristatella. nachweisbares Sekret vermittelt wird, und denke,, daß die, räumlichen
Schwierigkeiten, die dabei entstehen, teils durch eine Stauung der Zellen am Schalenrande (Schwimmringregion),
teils durch die Tätigkeit der epithelialen Muskulatur der Leibeswand, überwunden werden.,
Das Vorrücken; der Polypidmündung einerseits und das Zurückweichen des Funiculus und der
freien Muskeln andererseits ist aber nicht etwas dem Statoblasten Eigentümliches, sondern findet
sich ganz ähnlich auch bei der Knospung im Stocke.. Hier hat D a v e n p o, r t (1. e., S. 142 f.) im
Gegensatz zu meinen Ansichten vom Wachstum der Leibeswand behauptet, daß der Funiculus und
die Muskeln durch amöboide Wanderzellen von ihren Ursprungsorten entführt würden, daß sie also
nicht zugleich mit der Leibeswand vorrückten, sondern an andere Stellen derselben verpflanzt würden.
Das würde denn auch für ihren Ortswechsel im Statoblasten, anzunehmen sein. Obwohl ich nun zwar
für die Beteiligung amöboider Zellen des mesodermalen Blattes bei der Bildung der genannten Olgane,
im Stocke vielfache, von mir früher nicht voll gewürdigte Anzeichen gefunden habe, so kann ich doch
daraus nicht die nämlichen Schlüsse ziehen wie Davenport, und gerade der Statoblast scheint mir
sehr deutlich gegen dieselben zu sprechen. Zunächst kommt für das Vorrücken der Polypidmündung
eine Verpflanzung durch Wanderzellen sicherlich nicht in Frage, und doch wird man annehmen
dürfen, daß diese Verlagerung auf den gleichen Ursachen beruht wie die damit Hand in Hand gehende
des Funiculus und der Muskeln. Sodann heißt es wohl dem Verständnis oder der Zielstrebigkeit der,
Wanderzellen zuviel Zutrauen, wenn man glaubt, daß die letzteren alle jene zahlreichen Einzelgebilde in
den richtigen Bahnen und den richtigen gegenseitigen Entfernungen an der Leibeswand hinführen
könnten. Und endlich muß es auch ihr physisches Leistungsvermögen übersteigen. Denn der Dotter bildet
noch immer eine kompakte Masse von Körnern, die einem durch sie hindurchgeführten Körper einen
beträchtlichen Widerstand bieten muß, wobei außerdem zu berücksichtigen wäre, ob nicht auf diesem
Stadium die Muskeln unter einer gewissen Spannung stehen, so daß sie an ihren Endpunkten einen
Zug ausüben, den die Wanderzellen bei der Loslösung der Fasern ebenfalls zu überwinden hätten.
Das sind die Gründe, die mir die Ansicht von Davenport als nicht haltbar erscheinen lassen.
Schließlich sei noch der medianen Verbindung der Lophophorarme gedacht, auf die D a v e n p
o r t zuerst aufmerksam gemacht hat (1. Ci, S. 130 f. und 134). Er beschreibt sie ausführlich bei
Cristatella und gibt sie auch für Pectinatella an. Im Statoblasten ist sie gleichfalls vorhanden. Sie
ist schon im Stadium Fig. 36 bei V sichtbar (vgl. Fig. 37) und erstreckt sich von der Afterregion in
der Richtung auf die Spitze der Arme, um so weiter, je länger dieselben weiden (Fig. 38). Bevor das
Polypid ausstreekbar wird, hört die Verbindung auf, und zwar besteht sie nach Davenport am längsten
in ihrem distalen Teil, an der Spitze der Arme. Sie ist also nur eine zeitweilige, und ich nehme an,
daß sie dadurch zustande kommt, daß die Lophophorarme verbunden auf wachsen, woraus zugleich
folgen würde, daß deren Wachstum sich nicht an der Spitze, sondern vornehmlich an der Basis vollzieht^;)
Daß es kein überwiegendes Spitzenwachstum ist, hat Davenport ausdrücklich betont. So
entgeht man der Annahme einer sekundären Verschmelzung der Arme, ein Vorgang, der völlig rätselhaft
wäre und der auch durch nichts bewiesen ist. Beim ausgebildeten Tiere würde die Verwachsungslinie
an der inneren Biegung der hufeisenförmigen Tentakelkrone und weit unterhalb der Tentakelbasis
zu suchen sein.
Die Bildung der Tochterknospen.
Taf. VI und VII.
Der auffälligste Unterschied, der die Entwickelung in unseren beiden Fällen, bei Cristatella
und Pectinatella, kennzeichnet, liegt in der Bildung der-zweiten Knospe, also der ersten Tochterknospe.
Während diese bei Cristatella > in weiter Entfernung von der Hauptknospe ihren Ursprung
nimmt, steht sie; bei Pectinatella von vornherein in enger Verbindung mit ihr, derart, daß auf gewissen
Stadien bereits , die typischen Formen der Doppelknospe zu Tage treten.
'Die erste Andeutung der jüngeren Knospe finden wir in Fig. 26, Taf. VI, auf einem Stadium,
wo der Analschlauch sich eben zu bilden beginnt. Die Statoblastenwand ist an der Oralseite der Hauptknospe
und in unmittelbarem Zusammenhang mit ihr stark verdickt (bei B). Diese Verdickung
hat in Fig. 29 und 31 erheblich zugenommen, in Fig. 31 wölbt sie sich schon in Gestalt einer Beule
nach innen vor. In Fig. 32 ist in der Tochterknospe ein Lumen zu Tage getreten, d.as, wenn auch nicht
durchweg als offener Spalt, bis zu dem Lumen der Hauptknospe verfolgt werden kann. Es ist dadurch
entstanden, daß die beiden Blätter der Verdickung sich sackartig einbogen. Von den Rändern des
Sackes her haben sich Zellen des inneren Knospenblattes über die Öffnung herübergeschoben, so
daß nun oberhalb beider Knospen eine neue, übrigens nur provisorische Zellschicht eingeschaltet ist.
Auf diesem Stadium liegt uns das typische Bild einer Doppelknospe vor Augen.
Die weitere Entwickelung verhält sich genau so, wie es bei den Doppelknospen der Phylacto-
lämen im allgemeinen der Fall istt ,(ygl. Untersuch., S. 19 ff.), nur mit den für Pectinatella charakteristischen
Modifikationen in der Zahl und Zeitfolge der Knospen.
Vom Stadium Fig. 32 ab rücken die beiden Knospen mehr und mehr auseinander, indem die
verbindende Zellbrücke in die Leibeswand übergeht (Fig. 34-t-40), der aus dem embryonalen Material
der Knospen fortgesetzt neue Baustoffe zufließen. In Fig. 38, Taf. VII, ist eine dritte Knospe, C, aufgetreten,
' die aus der Halsregion der zweiten, B, von vornherein als typische Doppelknospe entspringt
und selbst wieder eine vierte (Fig. 40, D) auf gleiche Weise hervorbringt. Diese vier Knospen ent-1