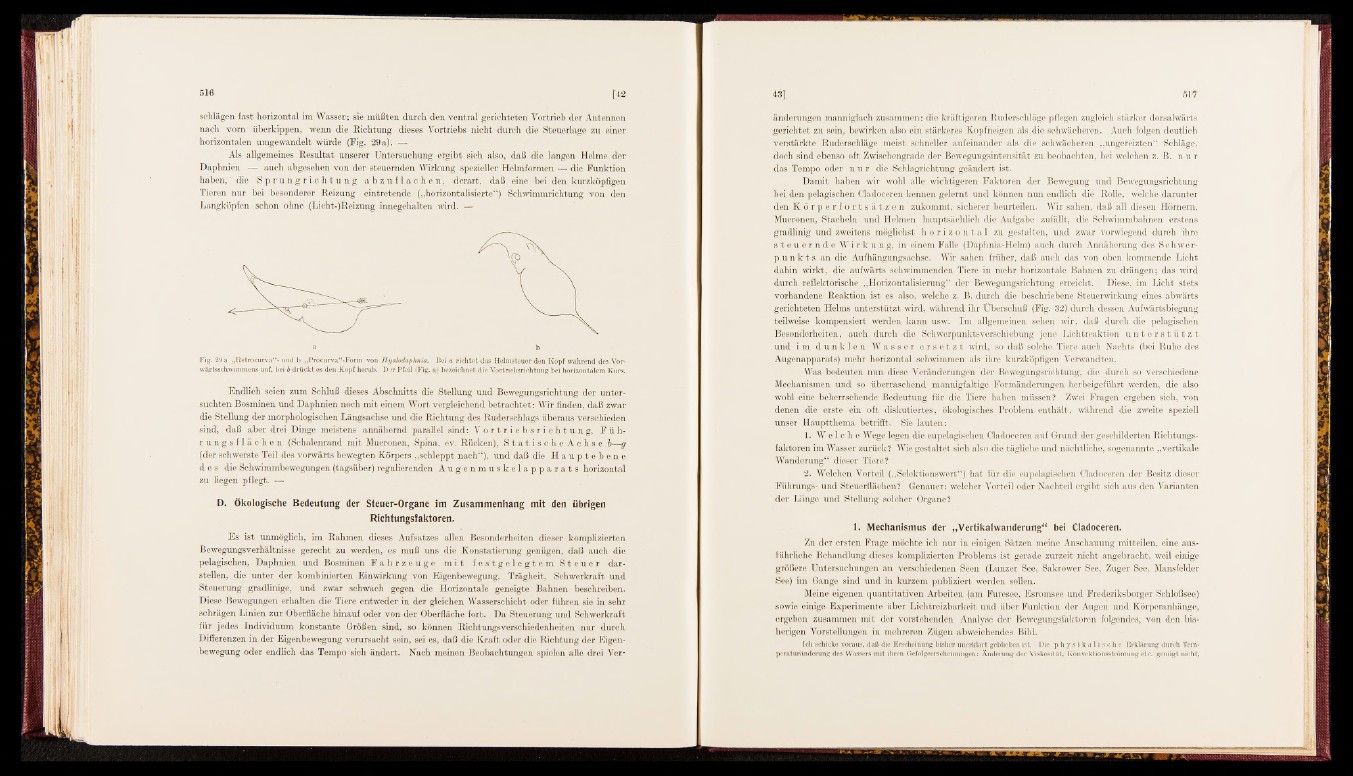
schlagen fast horizontal im Wasser; sie müßten durch den ventral gerichteten Vortrieb der Antennen
nach vorn überkippen, wenn die Richtung dieses Vortriebs nicht durch die Steuerlage zu einer
horizontalen umgewandelt würde (Fig. 29 al.p|fgl|ai
Als allgemeines Resultat unserer Untersuchung ergibt sich also, daß die langen Helme der
Daphnien — auch abgesehen von der steuernden Wirkung spezieller Helmformen — die Funktion
haben, die S p r u n g r i c h t u n g a b z u f l a c h e n , derart, daß eine bei den kurzköpfigen
Tieren nur bei besonderer Reizung eintretende („horizontalisierte“) Schwimmrichtung von den
Langköpfen schon ohne (Licht-)Reizung innegehalten wird. —
a b
Fig. 29 a „Retrocurva“ - und b „Procurva“ -Form von Hyalodaphnia. Bei a r ich te t das Helmsteuer den Kopf während des Vorwärtsschwimmens
auf, bei b drückt e s den Kopf h erab. Dar Pfeil (Fig. a) bezeichnet die Vortriebsrichtung b ei horizontalem Kurs.
Endlich seien zum Schluß dieses Abschnitts die Stellung und Bewegungsrichtung der untersuchten
Bosminen und Daphnien noch mit einem Wort vergleichend betrachtet: Wir finden, daß zwar
die Stellung der morphologischen Längsachse und die Richtung des Ruderschlags überaus verschieden
sind, daß aber drei Dinge meistens annähernd parallel sind: Vo r t r i e b s r i c h t u n g , Fü hr
u n g s f l ä c h e n (Schalenrand mit Mucronen, Spina, ev. Rücken), S t a t i s c h e Achs e b—g
(der schwerste Teil des vorwärts bewegten Körpers „schleppt nach“), und daß die Ha u p t e b e n e
des die Schwimmbewegungen (tagsüber) regulierenden A u g e nmu s k e l a p p a r a t s horizontal
zu liegen pflegt. —
D. Ökologische Bedeutung der Steuer-Organe im Zusammenhang mit den übrigen
Richtungsfaktoren.
Es ist unmöglich, im Rahmen dieses Aufsatzes allen Besonderheiten dieser komplizierten
Bewegungsverhältnisse gerecht zu werden, es muß uns die Konstatierung genügen, daß auch die
pelagischen, Daphnien und Bosminen F a h r z e u g e mi t f e s t g e l e g t em S t e u e r darstellen,
die unter der kombinierten Einwirkung von Eigenbewegung, Trägheit, Schwerkraft und
Steuerung gradlinige, und zwar schwach gegen die Horizontale geneigte Bahnen beschreiben.
Diese Bewegungen erhalten die Tiere entweder in der gleichen Wasserschicht oder führen sie in sehr
schrägen Linien zur Oberfläche hinauf oder von der Oberfläche fort. Da Steuerung und Schwerkraft
für jedes Individuum konstante Größen sind, so können Richtungsverschiedenheiten nur durch
Differenzen in der Eigenbewegung verursacht sein, sei es, daß die Kraft oder die Richtung der Eigenbewegung
oder endlich das Tempo sich ändert. Nach meinen Beobachtungen spielen alle drei Veränderungen
mannigfach zusammen: die kräftigeren Ruderschläge pflegen zugleich stärker dorsalwärts
gerichtet zu sein, bewirken also ein stärkeres Kopfneigen als die schwächeren. Auch folgen deutlich
verstärkte Ruderschläge meist schneller aufeinander als die schwächeren „ungereizten“ Schläge,
doch sind ebenso oft Zwischengrade der Bewegungsintensität zu beobachten, bei welchen z. B. n u r
das Tempo oder n u r die Schlagrichtung geändert ist.
Damit haben wir wohl alle wichtigeren Faktoren der Bewegung und Bewegungsrichtung
bei den pelagischen Cladoceren kennen gelernt und können nun endlich die Rolle, Welche darunter
den K ö r p e r f o r t s ä t z e n zukommt, sicherer beurteilen. Wir sahen, daß all diesen Hörnern,
Mucronen, Stacheln und Helmen hauptsächlich die Aufgabe zufällt, die Schwimmbahnen erstens
gradlinig und zweitens möglichst h o r i z o n t a l zu gestalten, und zwar vorwiegend durch ihre
s t e u e r n d e Wi rkung, in einem Falle (Daphnia-Helm) auch durch Annäherung des Schwer-
p u n k t s an die Aufhängungsachse. Wir sahen früher, daß auch das von oben kommende Licht
dahin wirkt, die aufwärts schwimmenden Tiere in mehr horizontale Bahnen zu drängen; das wird
durch reflektorische „Horizontalisierung“ der Bewegungsrichtung erreicht. Diese, im Licht stets
vorhandene Reaktion ist es also, welche z. B. durch die beschriebene Steuerwirkung eines abwärts
gerichteten Helms unterstützt wird, während ihr Überschuß (Fig. 32) durch dessen Aufwärtsbiegung
teilweise kompensiert werden kann usw. Im allgemeinen sehen wir, daß durch die pelagischen
Besonderheiten, auch durch die Schwerpunktsverschiebung jene Lichtreaktion u n t e r s t ü t z t
und im d u n k l e n Was s e r e r s e t z t wird, so daß solche Tiere auch Nachts (bei Ruhe des
Augenapparats) mehr horizontal schwimmen als ihre kurzköpfigen Verwandten.
Was bedeuten nun diese Veränderungen der Bewegungsrichtung, die durch so verschiedene
Mechanismen und so überraschend mannigfaltige Formänderungen herbeigeführt werden, die also
wohl eine beherrschende Bedeutung für die Tiere haben müssen? Zwei Fragen ergeben sich, von
denen die erste ein oft diskutiertes, ökologisches Problem enthält, während die zweite speziell
unser Hauptthema betrifft. Sie lauten:
1. We l c he Wege legen die eupelagischen Cladoceren auf Grund der geschilderten Richtungsfaktoren
im Wasser zurück? Wie gestaltet sich also die tägliche und nächtliche, sogenannte „vertikale
Wanderung“ dieser Tiere?
2. Welchen Vorteil („Selektionswert“) hat für die eupelagischen Cladoceren der Besitz dieser
Führungs- und Steuerflächen? Genauer: welcher Vorteil oder Nachteil ergibt sich aus den Varianten
der Länge und Stellung solcher Organe?
1. Mechanismus der „Vertikal Wanderung“ bei Cladoceren.
Zu der ersten Frage möchte ich nur in einigen Sätzen meine Anschauung mitteilen, eine ausführliche
Behandlung dieses komplizierten Problems ist gerade zurzeit nicht angebracht, weil einige
größere Untersuchungen an verschiedenen Seen (Lunzer See, Sakrower See, Zuger See, Mansfelder
See) im Gange sind und in kurzem publiziert werden sollen.
Meine eigenen quantitativen Arbeiten (am Furesee, Esromsee und Frederiksborger Schloßsee)
sowie einige Experimente über Lichtreizbarkeit und über Funktion der Augen und Körperanhänge,
ergeben zusammen mit der vorstehenden Analyse der Bewegungsfaktoren folgendes, von den bisherigen
Vorstellungen in mehreren Zügen abweichendes Bild.
Ich schicke voraus, daß die Erscheinung bisher unerklärt geblieben ist. Die p h y s i k a l i s c h e Erklärung durch Temperaturänderung
des Wassers mit ihren Gefolgeerscheinungeh: Änderung der Viskosität, Konvektionsströmung etc. genügt nicht,