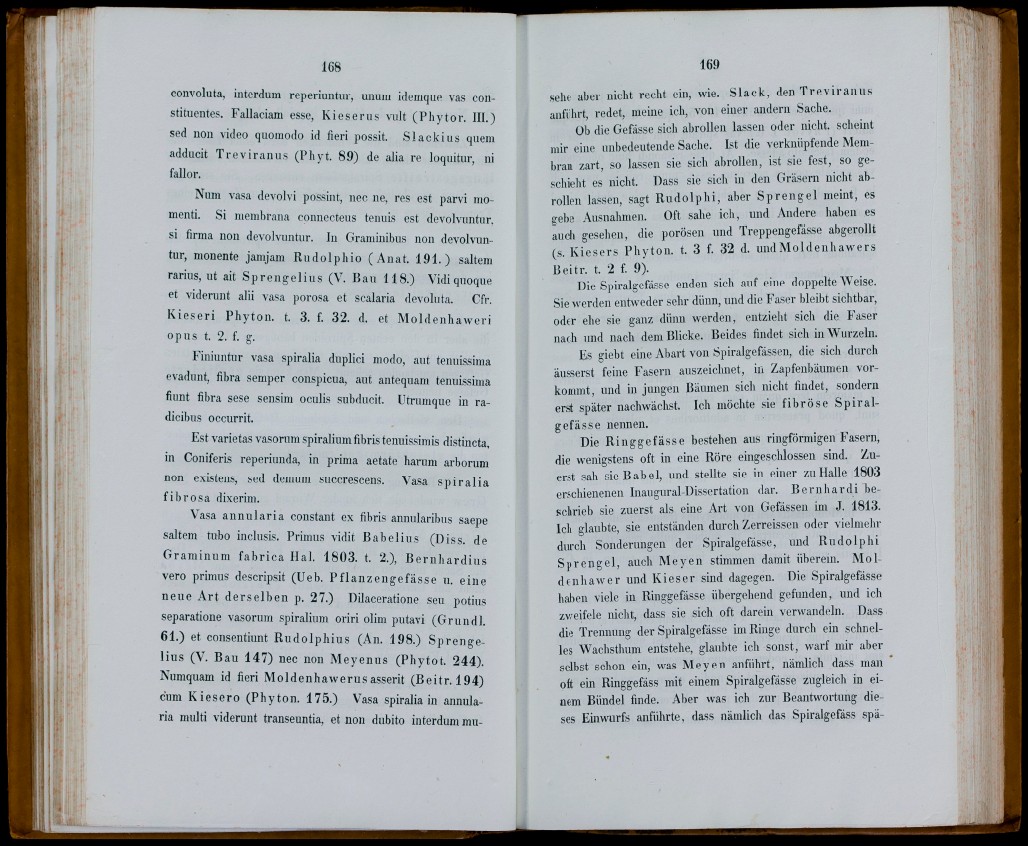
m M:
•
... IJ
1I
i-i 1
1 i
•itl^ i -
• IN
Iéii
168
convoluta, interdum reperiuntur, unum idemque vas constituentes.
Fallaciam esse, Kies er us vult (Phytor. III.)
sed non video quomodo id fieri possit. Slackius quern
adducit Treviranus (Phyt. 89) de alia re loquitur, ni
fallor.
Num vasa devolvi possint, nee ne, res est parvi momenti.
Si membrana cpnnecteus tenuis est devolvuntur,
si firma non devolvuntur. In Graminibus non devolvuntur,
monente jamjam Rndolphio (Anat. 1.91.) saltern
rarius, ut ait Sprengel ius (V. Bau 118.) Vidi quoque
et viderunt alii vasa porosa et scalarla devoluta. Cfr.
Kieseri Phyton, t. 3. f. 32. d. et Moldenhaweri
opus t. 2. f. g.
Finiuntur vasa spiralia duplici modo, aut tenuissima
evadnnt, fibra semper conspicua, aut antequam tenuissima
fiunt fibra sese sensim oculis subducit. Utrumque in radicibus
occurrit.
Est varietas vasorum spiralium fibris tenuissimis distincta,
in Coniferis reperiunda, in prima aetate harum arborum
non existens, sed demum succrescens. Vasa spiralia
f i b r o s a dixerim.
Vasa annui ari a constant ex fibris annularibus saepe
saltem tubo inclusis. Primus vidit Babelius (Diss, de
Graminum fabrica Hai. 1803. t. 2.), Bernhardius
vero primus descripsit (Ueb. Pflanzengefässe u. eine
neue Art derselben p. 27.) Dilaceratione seu potius
separatione vasorum spiralium oriri olim putavi (Gründl.
61.) et consentinnt Rudolpliius (An. 198.) Sprengelius
(V. Bau 147) nec non Meyenus (Phytot. 244).
Numquam id fieri Moldenhawerus asserii (Beitr. 194)
cum Kies e ro (Phyton. 175.) Vasa spiralia in annularia
multi viderunt transeuntia, et non dubito interdum mu-
169
sehe aber nicht recht ein, wie. Slack, den Treviranus
anführt, redet, meine ich, von einer andern Sache.
Ob die Gefässe sich abrollen lassen oder nicht, scheint
mir eine unbedeutende Sache. Ist die verknüpfende Membran
zart, so lassen sie sich abrollen, ist sie fest, so geschieht
es nicht. Dass sie sich in den Gräsern nicht abrollen
lassen, sagt Rudolphi, aber Sprengel meint, es
gebe Ausnahmen. Oft sähe ich, und Andere haben es
auch gesehen, die porösen und Treppengefässe abgerollt
(s. Kiesers Phyton, t. 3 f. 32 d. undMoldenhawers
Beitr. t. 2 f. 9>
Die Spiralgefässe enden sich auf eine doppelte Weise.
Sie werden entweder sehr dünn, und die Faser bleibt sichtbar,
oder ehe sie ganz dünn werden, entzieht sich die Faser
nach und nach dem Blicke. Beides findet sich in Wurzeln.
Es giebt eine Abart von Spiralgefässen, die sich durch
äusserst feine Fasern auszeichnet, in Zapfenbäumen vorkommt,
und in jungen Bäumen sich nicht findet, sondern
erst später nachwächst. Ich möchte sie fibröse Spiralgefässe
nennen.
Die Ringgefässe bestehen aus ringförmigen Fasern,
die wenigstens oft in eine Röre eingeschlossen sind. Zuerst
sah sie Babel, und stellte sie in einer zu Halle 1803
erschienenen Inaugural-Dissertation dar. Bernhardi beschrieb
sie zuerst als eine Art von Gefässen im J. 1813.
Ich glaubte, sie entständen durch Zerreissen oder vielmehr
durch Sonderungen der Spiralgefässe, und Rudolphi
Sprengel, auch Meyen stimmen damit überem. Moldenhawer
und Kies er sind dagegen. Die Spiralgefässe
haben viele in Ringgefässe übergehend gefunden, und ich
zweifele nicht, dass sie sich oft darein verwandeln. Dass
die Trennung der Spiralgefässe im Ringe durch ein schnelles
Wachsthum entstehe, glaubte ich sonst, warf mir aber
selbst schon ein, was Meyen anführt, nämlich dass man
oft ein Ringgefäss mit einem Spiralgefässe zugleich in einem
Bündel finde. Aber was ich zur Beantwortung dieses
Einwurfs anführte, dass nämlich das Spiralgefäss späil
•
.t
i;