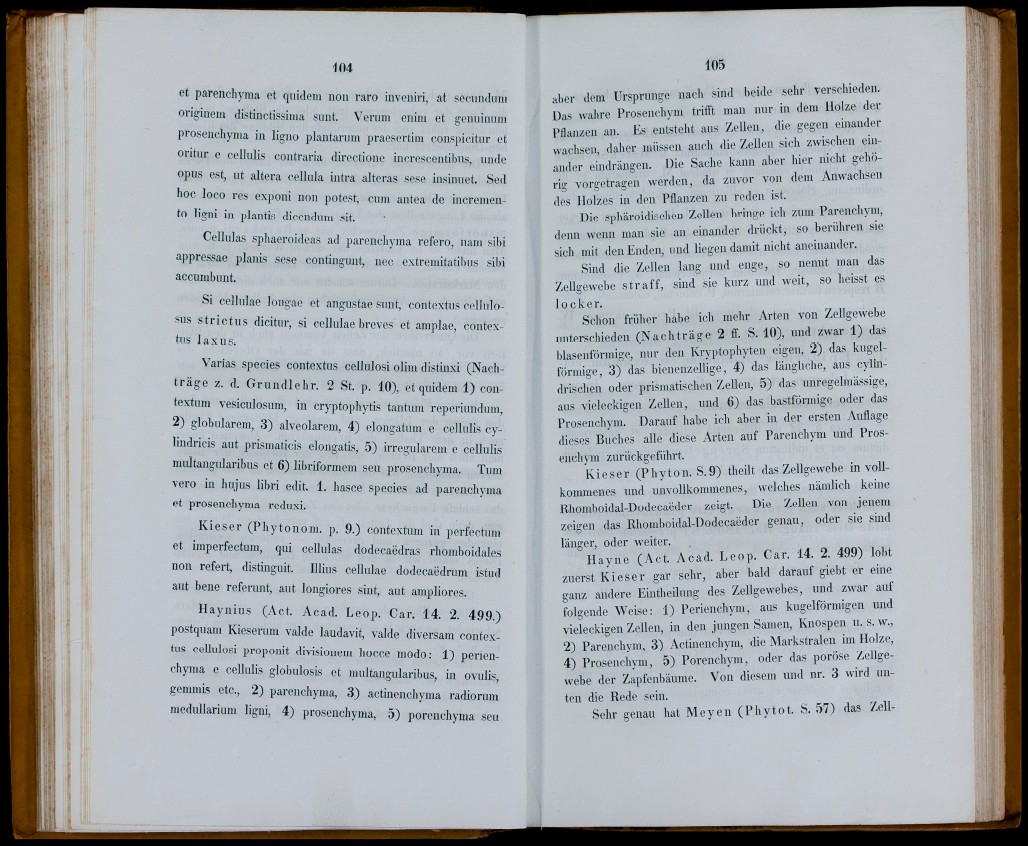
W fi
104
et parenchyma et quideni non raro inveniri, at secundniu
onginem distinctissima sunt. Verum enim et genuinum
prosencliynia in ligno plantarum praesertini conspicitnr et
ontur e cellulis contraria directione increscentibns, unde
opus est, ut altera cellula intra alteras sese insinuet. Sed
hoc loco res exponi non potest, cum antea de incremento
ligni in plantis dicendum sit.
Cellulas sphaeroideas ad parenchyma refero, nam sibi
appressae planis sese contingunt, nec extremitatibus sibi
accumbunt.
Si cellulae longae et angustae sunt, contextus cellulosns
strictus dicitur, si cellulae breves et amplae, contextus
lax US.
Varias species contextus celluiosi olim distinxi (Nacht
r ä g e z. d. Grundlehr. 2 St. p. 10), et quidem 1) contextum
vesiculosum, in cryptophytis tantum reperiundum,
2) globularem, 3) alveolarem, 4) elongatum e cellulis cylindricis
aut prismaticis elongatis, 5) irregulärem e cellulis
multangularibus et 6) libriformem seu prosenchyma. Tum
vero in hujus libri edit. 1. hasce species ad parenchyma
et prosenchyma reduxi.
Kies er (Phytonom. p. 9.) contextum in perfectum
et imperfectum, qui cellulas dodecaedras rhomboidales
non refert, distinguit. Illius cellulae dodecaedrum istud
aut bene referunt, aut longiores sint, aut ampliores.
Haynius (Act. Acad. Leop. Car. 14. 2. 499.)
postquam Kieserum valde laudavit, valde diversam contextus
celluiosi proponit divisionem hocce modo: 1) perienchyma
e cellulis globulosis et multangularibus, in ovulis,
gemmis etc., 2) parenchyma, 3) actinenchyma radiorum
medullarium ligni, 4) prosenchyma, 5) porenchyma seu
105
Hber dem Ursprünge nach sind beide sehr verschieden.
Das wahre Prosenchym trifft man nur in dem Holze der
Pflanzen an. Es entsteht aus Zellen, die gegen emander
wachsen, daher müssen auch die Zellen sich zwischen emander
eindrängen. Die Sache kann aber hier nicht gehörig
vorgetragen werden, da zuvor von dem Anwachsen
des Holzes in den Pflanzen zu reden ist.
Die sphäroidischen Zellen bringe ich zum Parenchym,
denn wenn man sie an einander drückt, so berühren sie
sich mit den Enden, und liegen damit nicht aneinander.
Sind die Zellen lang und enge, so nennt man das
Zellgewebe straff, sind sie kurz und weit, so heisst es
^ " ' ' ^ s X n früher habe ich mehr Arten von Zellgewebe
unterschieden (Nachträge 2 ff. S. 10), und zwar 1) das
blasenförmige, nur den Kryptophyten eigen, 2) das kugelförmige,
3) das bienenzellige, 4) das längliche, aus cylmdrischen
oder prismatischen Zellen, 5) das unregelmassige,
aus vieleckigen Zellen, und 6) das bastförmige oder das
Prosenchym. Darauf habe ich aber in der ersten Auflage
dieses Buches alle diese Arten auf Parenchym und Prosenchym
zurückgeführt.
K i e s e r (Phyton. S.9) theilt das Zellgewebe m vollkommenes
und unvollkommenes, welches nämlich keine
Rhomboidal-Dodecaeder zeigt. Die Zellen von jenem
zeigen das Rhomboidal-Dodecaeder genau, oder sie sind
länger, oder weiter. . ^ , i.
Hayne (Act. Acad. Leop. Car. 14. 2. 499) lobt
zuerst Kieser gar sehr, aber bald darauf giebt er eine
ganz andere Eiiitheilung des Zellgewebes, und zwar auf
folgende Weise: 1) Perienchym, aus kugelförmigen und
vieleckigen Zellen, in den jungen Samen, Knospen u. s. w.,
2) Parenchym, 3) Actinenchym, die Markstralen im Holze,
4) Prosenchym, 5) Porenchym, oder das poröse Zellgewebe
der Zapfenbäume. Von diesem und nr. 3 wird unten
die Rede sein.
Sehr genau hat M e y e n (Phytot. S. 57) das Zeilm
\ n^i
lìii
•Jf iMV
¡tili'Ini?, 1 filmi
I j ' l ' i . I-i,.-:..
> ;'•