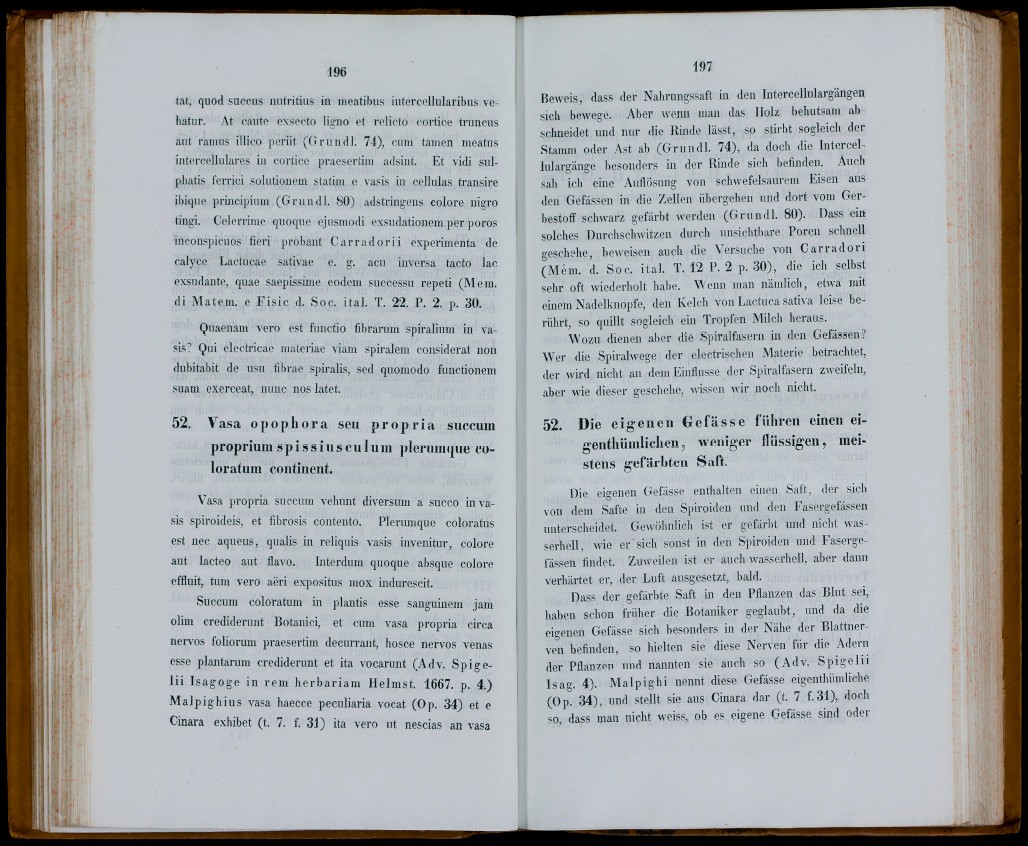
•
»
I' i; "
1
, T
1 •
sk ; i ;I J I I < i i i . . »
.
1
-iH'r
• iMV
..í
Vi
, (
I v ' i ^ 1
( .
196
tat, quod succiis nuíritius in laeatibus intercollularibiis veliatur.
At caute exsecto ligno et relicto cortice truiicus
ant rauuis illico periit (Gründl. 74), cum tarnen meatus
intercellulares iji cortice praesertim adsint. Et vidi sulphatis
ferrici solutiouem statini e vasis in cellulas ti-ansire
ibique principium (Gründl. SO) adstringens colore nigro
tingi. Celerrime quoque ejusmodi exsudationem per poros
inconspicuos fieri probant Car r a d or i i experimenta de
calyce Lactucae sativae e. g. acu inversa tacto lac
exsudante, quae saepissime eodem successu repeti (Mem.
di Matem. e Fisi c d. Soc. ital. T. 22. P. 2. p. 30.
Quaenam vero est functio fibrarum spiralium in vasis?
Qui electricae materiae viam spiralem considérât non
dubitabit de usu fibrae spiralis, sed quomodo functionem
suam exerceat, nunc nos latet.
52. Vasa opophora seu propria siiccum
proprium spi s s ius c i i lum plerumqiie coloratum
continent.
Vasa propria succum vehunt diversum a succo in vasis
spiroideis, et fibrosis contento. Plerumque coloratus
est nec aqueus, qualis in reliquis vasis invenitur, colore
aut lácteo aut flavo. Interdum quoque absque colore
effluit, tum vero aëri expositus mox indurescit.
Succum coloratum in plantis esse sanguinem jam
dim crediderunt Botanici, et cum vasa propria circa
ñervos foliorum praesertim decurrant, hosce ñervos venas
esse plantarum crediderunt et ita vocarunt (Adv. Spigel
i i Isagoge in rem herbariam Helmst. 1667. p. 4.)
M a l p i g h i u s vasa haecce peculiaria vocat (Op. 34) et e
Cinara exhibet (t. 7. f. 31) ita vero ut nescias an vasa
197
Beweis, dass der Nahrungssaft in den Intercellulargängeii
sich bewege. Aber wenn man das Holz behutsam abschneidet
und nur die Rinde lässt, so stirbt sogleich der
Stamm oder Ast ab (Gründl. 74), da doch die Intercellulargänge
besonders in der Rinde sich befinden. Auch
sah ich eine Auflösung von schwefelsaurem Eisen aus
den Gefässen in die Zellen übergehen und dort vom Gerbestoff
schwarz gefärbt werden (Gründl. 80). Dass em
solches Durchschwitzen durch unsichtbare Poren schnell
geschehe, beweisen auch die Versuche von Carradori
(Mem. d. Soc. ital. T. 12 P. 2 p. 30), die ich selbst
sehr oft Aviederholt habe. A^'enn man nämlich, etwa mit
einem Nadelknopfe, den Kelch von Lactuca sativa leise berührt,
so quUlt sogleich ein Tropfen Milch heraus.
Wozu dienen aber die Spiralfasern in den Gefässen?
Wer die Spiralwege der electrischen Materie betrachtet,
der wird nicht an dem Einflüsse der Spiralfasern zweifeln,
aber wie dieser geschehe, wissen wir noch nicht.
52. Die eigenen Gefasse führen einen eigenthümliclien,
weniger flüssigen, meistens
gefärbten Saft.
Die eigenen Gefässe enthalten einen Saft, der sich
von dem Safte in den Spiroiden und den Fasergefässen
unterscheidet. Gewöhnlich ist er gefärbt und nicht wasserhell,
wie er "sich sonst in den Spiroiden und Fasergefässen
findet. Zuweilen ist er auch Avasserhell, aber dann
verhärtet er, der Luft ausgesetzt, bald.
Dass der gefärbte Saft in den Pflanzen das Blut sei,
haben schon früher die Botaniker geglaubt, und da die
eigenen Gefässe sich besonders in der Nähe der Blattnerven
befinden, so hielten sie diese Nerven für die Adern
der Pflanzen und nannten sie auch so (Adv. Spigelii
Isag. 4). Malpighi nennt diese Gefässe eigenthümliche
(Op. 34), und stellt sie aus Cinara dar (t. 7 f.31), doch
so, dass man nicht weiss, ob es eigene Gefässe sind oder
i r .