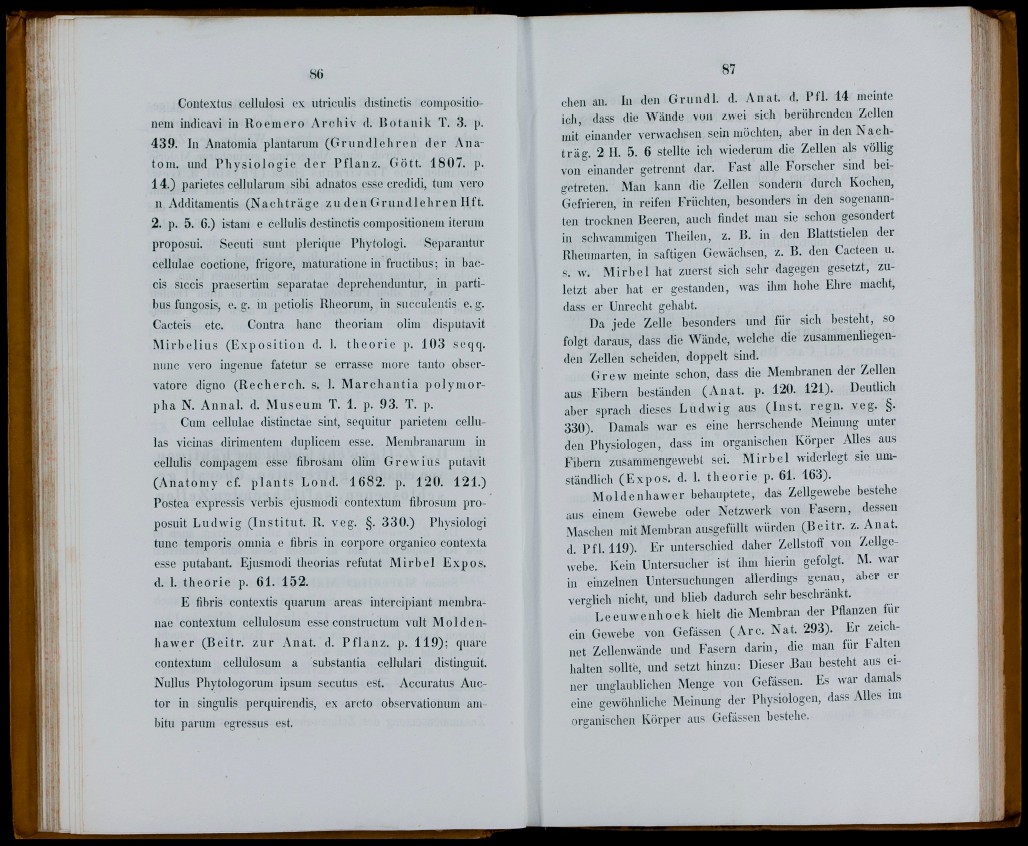
m
8(i
Contextus celluiosi ex iitriculis distinctis compositionem
indicavi iii Roemor o Archiv d. Botani k T. 3. p.
439. In Anatomia plantarum (Grundlehren der Anatom.
imd Physiologie der Pflanz. Gött. 1807. p.
14.) parietes cellularum sibi adnatos esse credidi, tum vero
n Additamentis (Nachträge zu den G rundl ehr e n Hft.
2. p. 5. 6.) istam e cellulis destinctis compositionem iterum
proposui, Secuti sunt plerique Phytologi. Separantur
cellulae coctione, frigore, maturatione in fructibus ; in baccis
siccis praesertim separatae deprehenduntur, in partibus
fungosis, e. g. ui petiolis Rheorum, in succulentis e. g.
Cacteis etc. Contra hanc theoriam olim disputavit
iNIirbelius (Exposition d. 1. theorie p. 103 seqq.
nunc vero ingenue fatetur se errasse more tanto observatore
digno (Recherch. s. 1. Ma r chant i a polymorpha
N. Annal, d. Museum T. 1. p. 93. T. p.
Cum cellulae distinctae sint, sequitur parietem cellulas
vicinas dirimentem duplicem esse. Membranarum in
cellulis compagem esse iibrosam olim Grewius putavit
(Anatomy cf. plants Lond. 1682. p. 120. 121.)
Postea expressis verbis ejusmodi contextum fibrosum proposuit
Ludwig (Institut. R. veg. §. 330.) Physiologi
tune temporis omnia e fibris in corpore organico contexta
esse putabant. Ejusmodi theorias réfutât Mirbel Expos,
d. 1. theor i e p. 61. 152.
E fibris contextis quarum areas intercipiant membranae
contextum cellulosum esse constructum vult Moldenhawer
(Beitr. zur Anat. d. Pflanz, p. 119); quare
contextum cellulosum a substantia cellulari distinguit.
Nullus Phytologorum ipsum secutus est. Accuratus Auctor
in singulis perquirendis, ex arcto observationum ambitu
parum egressus est.
87
chen an. In den Gründl, d. Anat. d. Pfl. 14 meinte
ich, dass die Wände von zwei sich berührenden Zellen
mit einander verwachsen sein möchten, aber in den Nachträg.
2 II. 5. 6 stellte ich wiederum die Zellen als völlig
von einander getrennt dar. Fast alle Forscher sind beigetreten.
Man kann die Zellen sondern durch Kochen,
Gefrieren, in reifen Früchten, besonders in den sogenannten
trocknen Beeren, auch findet man sie schon gesondert
in schwammigen Theilen, z. B. in den Blattstielen der
Rheumarten, in saftigen Gewächsen, z. B. den Cacteen u.
s. w. Mirbel hat zuerst sich sehr dagegen gesetzt, zuletzt
aber hat er gestanden, was ihm hohe Ehre macht,
dass er Unrecht gehabt.
Da jede Zelle besonders und für sich besteht, so
folgt daraus, dass die Wände, welche die zusammenliegenden
Zellen scheiden, doppelt sind.
G r ew meinte schon, dass die Membranen der Zellen
aus Fibern beständen (Anat. p. 120. 121). Deutlich
aber sprach dieses Ludwig aus (Inst. regn. veg. §.
330). Damals war es eine herrschende Meinung unter
den Physiologen, dass im organischen Körper Alles aus
Fibern zusammengewebt sei. Mirbel widerlegt sie umständlich
(Expos, d, L theor i e p. 61. 163).
M o l d e n h a w e r behauptete, das Zellgewebe bestehe
aus einem Gewebe oder Netzwerk von Fasern, dessen
Maschen mit Membran ausgefüllt würden (Beitr. z. Anat.
d. Pfl. 119). Er unterschied daher Zellstoff von Zellgewebe.
Kein Untersucher ist ihm hierin gefolgt. M. war
in einzelnen Untersuchungen allerdings genau, aber er
verglich nicht, und blieb dadurch sehr beschränkt.
L e e u w e n h o e k hielt die Membran der Pflanzen fur
ein Gewebe von Gefässen (Are. Nat. 293). Er zeichnet
Zellenwände und Fasern darin, die man für Falten
halten sollte, und setzt hinzu: Dieser JBau besteht aus einer
unglaublichen Menge von Gefässen. Es war damals
eine gewöhnliche Meinung der Physiologen, dass Alles mi
organischen Körper aus Gefässen bestehe.