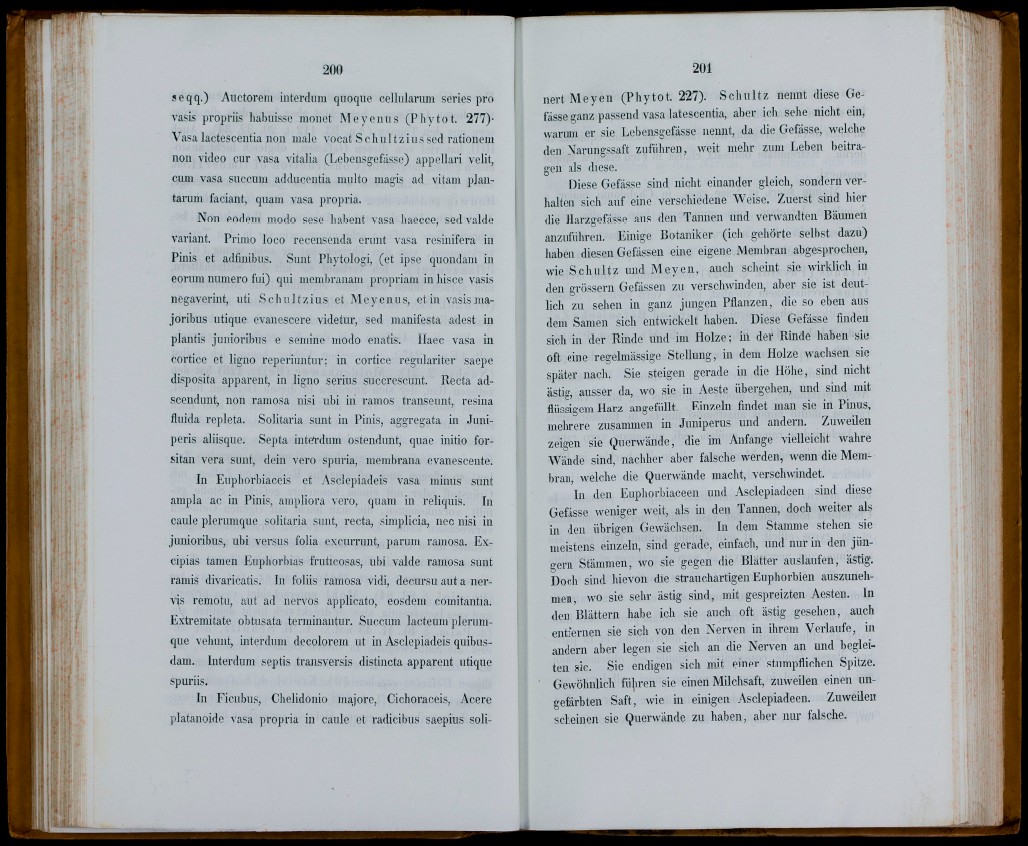
¿r!
IKB -I' i • ' ..fl'
.»i>r ¡
ih; • ' ; 'f<
^ I
•i I • ' jjr^ i. -
Uimrn ^
200
seqq.) Auctorem iiiterdum quoque cellularum series pro
vasis propriis Imbuisse monet Meyenus (Phytot. 277)-
Vasa lactesceutia non male vocat Schul tzius sed ratioiiem
non video cur vasa vitalia (Lebensgefasse) appellari velit,
cum vasa succum adducentia multo magis ad vltam pjantarum
faciant^ quam vasa propria.
Non eodem modo sese habent vasa haecce, sed valde
variant. Primo loco recensenda erunt vasa resinifera in
Pinis et adfinibus. Sunt Phytologi, (et ipse quondam in
eorum numero fui) qui membranam propx^iam in bisce vasis
negaverint, uti S c b u 11 z i u s et M e y e n u s, et in vasis majoribus
utique evanescere videtur, sed manifesta adest in
plantis junioribus e semine inodo enatis. llaec vasa in
cortice et ligno reperiuntur; in cortice regulariter saepe
disposita apparent, in ligno serins succrescunt. Recta adscendunt,
non ramosa nisi ubi in ramos transeunte resina
fluida repleta. Solitaria sunt in Pinis, aggregata in Juniperis
aliisque. Septa intetdum ostendunt, quae initio forsitan
vera sunt, dein vero spuria, membrana evanescente.
In Eupborbiaceis et Asclepiadeis vasa minus sunt
ampia ac in Pinis, ampliora vero, quam in reliquis. In
caule plerumque solitai'ia sunt, recta, Simplicia, nec nisi in
junioribus, ubi versus folia excurrunt, parum ramosa. Excipias
tamen Euphorbias fruticosas, ubi valde ramosa sunt
ramis divaricatis. In foliis ramosa vidi, decursu aut a nerves
remotu, aut ad ñervos applicato, eosdem comitantia.
E?¿tremitate obtusata terminantur. Succum lacteum plerumque
vehunt, interdum decolorem ut in Asclepiadeis quibusdam.
Interdum septis transversis distincta apparent utique
spuriis.
In Ficubus, Chelidonio majore, Cichoraceis, Acere
platanoide vasa propria in caule et radicibus saepius solin
1
1 iì f i u -i?
201
nert Meyen (Phytot. 227). Schultz nennt diese Gef
a s s e g a n z passend vasa latescentia, abei- ich sehe nicht ein,
warum.er sie Lebensgefässe nennt, da die Gefässe, welche
den Narungssaft zuführen, weit mehr zum Leben beitragen
als diese.
Diese Gefässe sind nicht einander gleich, sondern verhalten
sich auf eine verschiedene Weise. Zuerst sind hier
die Harzgefässe aus den Tannen und verwandten Bäumen
anzuführen. Einige Botaniker (ich gehörte selbst dazu)
haben diesen Gefässen eine eigene Membran abgesprochen,
wie Schultz und Meyen, auch scheint sie wirklich in
den grössern Gefässen zu verschwinden, aber sie ist deutlich
zu sehen in ganz jungen Pflanzen, die so eben aus
dem Samen sich entwickelt haben. Diese Gefässe finden
sich in der Rinde und im Holze; in der Rinde haben sie
oft eine regelmässige Stellung, in dem Holze wachsen sie
später nach. Sie steigen gerade in die Höhe, sind nicht
ästig, ausser da, wo sie in Aeste übergehen, und sind mit
flüssigem Harz angefüllt. Einzeln findet man sie in Pinns,
mehrere zusammen in Juniperus und andern. Zuweilen
zeigen sie Querwände, die im Anfange vielleicht wahre
Wände sind, nachher aber falsche werden, wenn die Membran,
welche die Querwände macht, verschwindet.
In den Euphorbiaceen und Asclepiadeen sind diese
Gefässe weniger weit, als in den Tannen, doch weiter als
in den übrigen Gewächsen. In dem Stamme stehen sie
meistens einzeln, sind gerade, einfach, und nur in den Jüngern
Stämmen, wo sie gegen die Blätter auslaufen, ästig.
Doch sind hievon die strauchartigen Euphorbien auszunehmen,
wo sie sehr ästig sind, mit gespreizten Aesten. In
den Blättern habe ich sie auch oft ästig gesehen, auch
entfernen sie sich von den Nerven in ihrem Verlaufe, in
andern aber legen sie sich an die Nerven an und begleiten
sie. Sie endigen sich mit einer stumpflichen Spitze.
Gewöhnlich fü|iren sie einen Milchsaft, zuweilen einen ungefärbten
Saft, wie in einigen Asclepiadeen. Zuweilen
scheinen sie Querwände zu haben, aber nur falsche.
iÄ