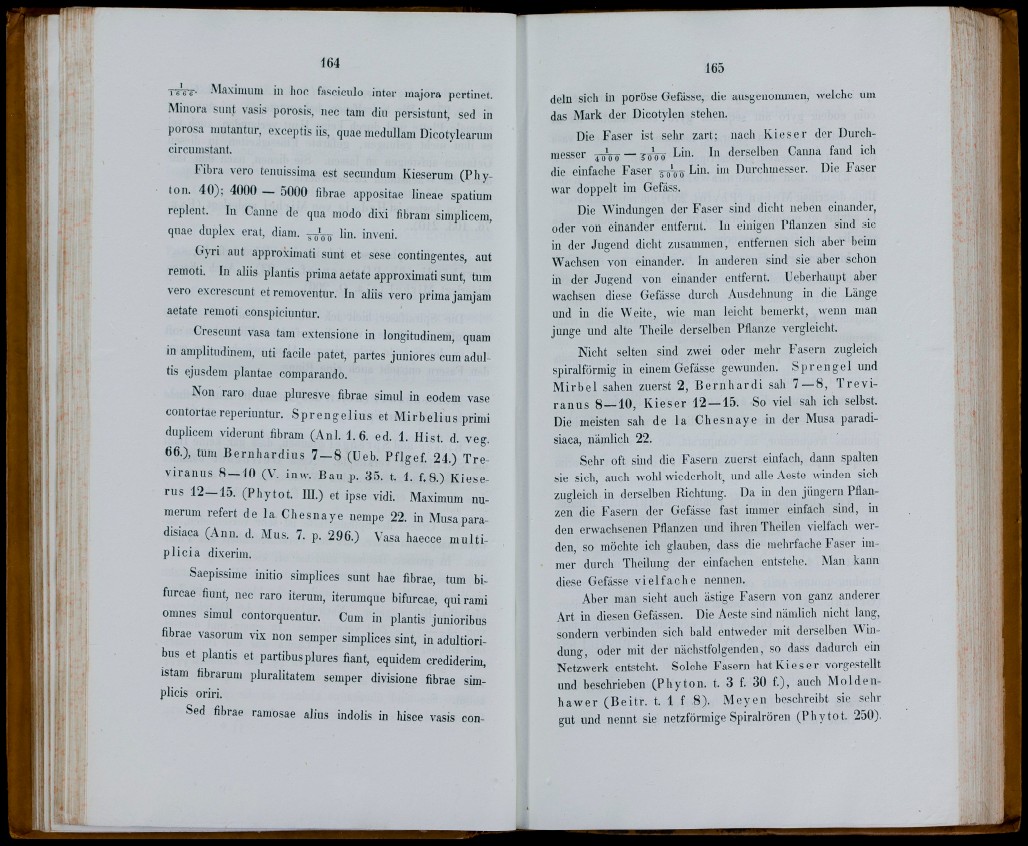
:-: I ,
J -
164
TeVe- Maximum in lioc fasciculo inter majora pertinet.
Minora sunt vasis porosis, nee tarn diu persistunt, sed in
porosa luutantur, exceptis iis, quae medullam Dicotylearum
circunistant.
Fibra vero tenuissima est secundum Kieserum (Phyton.
40); 4000 _ 5000 fibrae appositae lineae spatium
replent. In Canne de qua modo dixi fibram simplicem,
quae duplex erat, diam. ^ ^ o lin- inveni.
Gyri aut approximati sunt et sese contingentes, aut
remoti. In aliis plantis prima aetate approximati sunt, turn
vero excrescunt et removentur. In aliis vero prima jamjam
aetate remoti conspiciuntur.
Crescunt vasa tam extensione in longitudinem, quam
in amplitudinem, uti facile patet, partes juniores cum adultis
ejusdem plantae comparando.
Non raro duae pluresve fibrae simul in eodem vase
contortae reperiuntur. Sprengelius et Mi rbel ius primi
duplicem viderunt fibram (Ani. 1. 6. ed. 1. Hist. d. veg.
66.), tum Bernhardius 7 — 8 (Ueb. Pflgef. 24.) Trev
i r a n u s 8 - 1 0 (V. inw. Bau .p. 35. t. 1. f,8.) Kieserus
12-15. (Phytot. III.) et ipse vidi. Maximum numerum
refert de la Chesnaye nempe 22. in Musa paradisiaca
(Ann. d. Mus. 7. p. 296.) Vasa haecce multip
l i c i a dixerim.
Saepissime initio simplices sunt hae fibrae, tum bifurcae
fiunt, nec raro iterum, iterumque bifurcae, qui rami
omnes simul contorquentur. Cum in plantis junioribus
fibrae vasorum vix non semper simplices sint, in adultioribus
et plantis et partibusplures fiant, equidem crediderim,
istam fibrarum pluralitatem semper divisione fibrae simplicis
oriri.
Sed fibrae ramosae alius indolis in hisce vasis con-
165
dein sich in poröse Gefässe, die ausgenonunen, welche um
das Mark der Dicotylen stehen.
Die Faser ist sehr zart; nach Kies e r der Durchmesser
^Vö —ToVö Lin. In derselben Canna fand ich
die einfache Faser 50V0 Lin. im Durchmesser. Die Faser
war doppelt im Gefäss.
Die Windungen der Faser sind dicht neben einander,
oder von einander entfernt. In einigen Pflanzen sind sie
in der Jugend dicht zusammen, entfernen sich aber beim
Wachsen von einander. In anderen sind sie aber schon
in der Jugend von einander entfernt. Ueberhaupt aber
wachsen diese Gefässe durch Ausdehnung in die Länge
und in die Weite, wie man leicht bemerkt, wenn man
junge und alte Theile derselben Pflanze vergleicht.
Nicht selten sind zwei oder mehr Fasern zugleicli
spiralförmig in einem Gefässe gewunden. Sprengel und
M i r b e l sahen zuerst 2, Bernhardi sah 7—8, Trevir
a n u s 8 —10, Kieser 12 —15. So viel sah ich selbst.
Die meisten sah de la Chesnaye in der Musa paradisiaca,
nämlich 22.
Sehr oft sind die Fasern zuerst einfach, dann spalten
sie sich, auch wohl wiederholt, und alle Aeste winden sich
zugleich in derselben Richtung. Da in den Jüngern Pflanzen
die Fasern der Gefässe fast immer einfach sind, in
den erwachsenen Pflanzen und ihren Theilen vielfach werden,
so möchte ich glauben, dass die mehrfache Faser immer
durch Theilung der einfachen entstehe. Man kann
diese Gefässe v iel fache nennen.
Aber man sieht auch ästige Fasern von ganz anderer
Art in diesen Gefässen. Die Aeste sind nämlich nicht lang,
sondern verbinden sich bald entweder mit derselben Windung,
oder mit der nächstfolgenden, so dass dadurch ein
Netzwerk entsteht. Solche Fasern hat Ki e s e r vorgestellt
und beschrieben (Phyton, t. 3 f. 30 f.), auch Moldenh
a w e r (Beitr. t. 1 f .8). Meyen beschreibt sie sehr
gut und nennt sie netzförmige Spiralrören (Phytot. 250).
I
i :
'1
Ii!
H1 1
1 !
\\nur
\
r <:
Ì
4
-'-mm