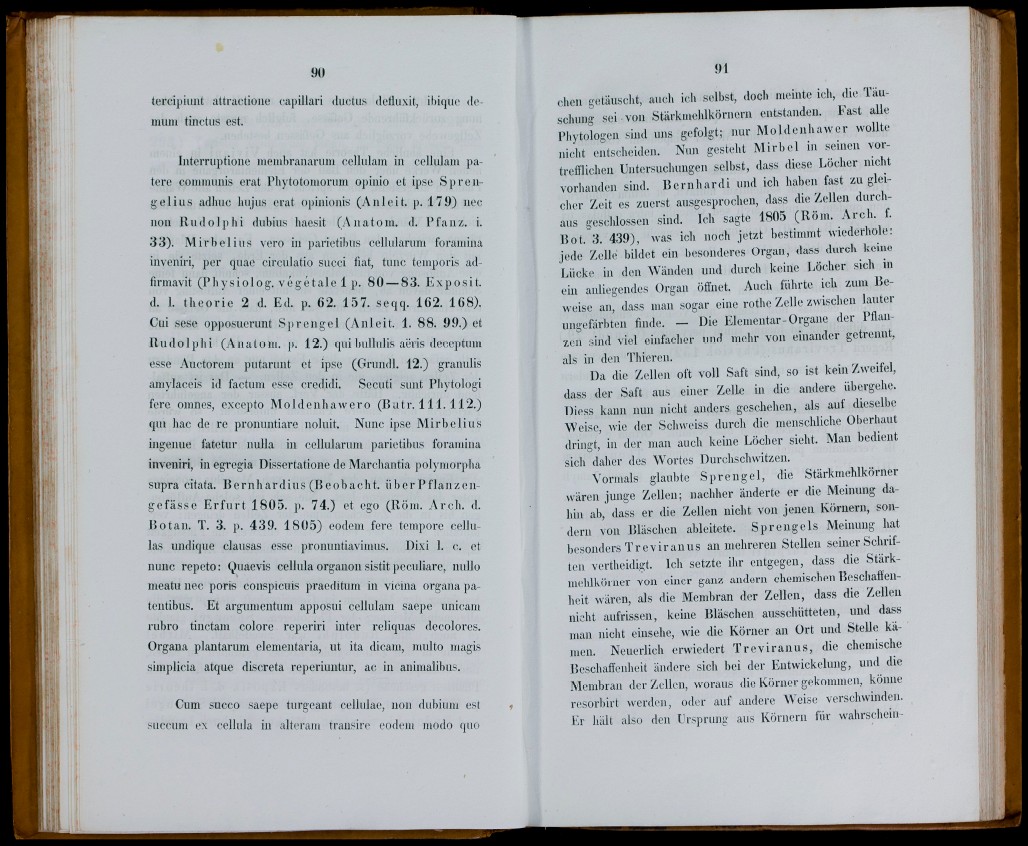
H'l i, :
- •
11: i : ;;
.1 ^
^ir:
90
tercipiunt attractioiie ciipillari ductus ileiluxit, il)ique deiiiuiu
tiactus est.
Iiiterruptione meiubranaruin cellulam in cellulam patere
communis erat Phytotomorum opinio et ipse Sprenge
l i u s iidhuc hujus erat opinioni^ (A n i e it. p. 17.9) nec
non Rudolphi dubius liaesit (Anatom, d. Pfanz. i.
33). Mirbelius vero in parietibus cellularnm foramina
inveniri, per quae circulatio succi fiat, tunc temporis adfn
mavit (Pl iysiolog, vegetal e 1 p. 80 — 83. Exposit.
d. 1. theor i e 2 d. Ed. p. 62. 157. seqq. 162. 168).
Cui sese opposuerunt Sprengel (Ani e it. 1. 88. i)9.) et
R u d o l p h i (Anatom, p. 12.) qui bullulis aeris deceptum
esse Auctorem putarunt et ipse (Gründl. 12.) granulis
amylaceis id factum esse credidi. Secuti siuit Pliytologi
fere omnes, excepto Moldenhawer o (Butr. 111.112.)
qui hac de re pronuntiare noluit. Nunc ipse Mirbelius
ingenue fatetur nulla in cellulariim parietibus foramina
inveniri, in egregia Dissertatione de Marcliantia polymorplia
supra citata. Bernhardius (Beobacht . über Pflanzeng
e f ä s s e Erfurt 1805. p. 74.) et ego (Rom. Arch. d.
Bo tan. T. 3. p. 439. 1805) eodem fere tempore cellulas
undique clausas esse pronuntiavimus. Dixi 1. c. et
nunc repeto: Quaevis cellula organon sistit peculiare, nullo
meatu nec poris conspicuis praeditum in vicina organa patentibus.
Et argumentum apposui cellulam saepe unicam
rubro tinctam colore reperiri inter reliquas decolores.
Organa plantarum elementaria, ut ita dicam, multo magis
simplicia atque discreta reperiuntur, ac in animalibus.
Cum succo saepe turgeant cellulae, non dubium est
succum ex cellula in alteriim transire eodem modo quo
j! ' • t
; J'
91
c-lien getäuscht, auch ich selbst, doch meinte ich, die Täuschung
sei von Stärkmehlkörnern entstanden. Bast alle
Phytologeu sind uns gefolgt; nur Moldenhawer wollte
niclit entscheiden. Nun gesteht Mirbel in seinen vortrefflichen
Untersuchungen selbst, dass diese Löcher nicht
vorhanden sind. Bernhardi und ich haben fast zu gleicher
Zeit es zuerst ausgesprochen, dass die Zellen durchaus
geschlossen sind. Ich sagte 1805 (Röm. Arch. f.
Bot. 3. 439), was ich noch jetzt bestimmt wiederhole:
jede Zelle bildet ein besonderes Organ, dass durch keine
Lücke in den Wänden und durch keine Löcher sich m
ein anliegendes Organ öffnet. Auch führte ich zum Beweise
an, dass man sogar eine rothe Zelle zwischen lauter
ungefärbten finde. - Die Elementar-Organe der Pflanzen
sind viel einfacher und mehr von einander getrennt,
als in den Thieren. . -p i
Da die Zellen oft voll Saft sind, so ist kein Zweiiel,
dass der Saft aus einer ZelLe in die andere übergehe.
Diess kann nun nicht anders geschehen, als auf dieselbe
Weise, Avie der Schweiss durch die menschliche Oberhaut
dringt,' in der man auch keine Löcher sieht. Man bedient
sich daher des Wortes Durchschwitzen.
Vormals glaubte Sprengel, die Stärkmehlkörner
wären junge Zellen; nachher änderte er die Meinung dahin
ab, dass er die Zellen nicht von jenen Körnern, sondern
von Bläschen ableitete. Sprengeis Meinung hat
besonders T r e v i r a n u s an mehreren Stellen seiner Schriften
vertheidigt. Ich setzte ihr entgegen, dass die Stärkmehlkörner
von einer ganz andern chemischen Beschaffenheit
wären, als die Membran der Zellen, dass die Zellen
nicht aufrissen, keine Bläschen ausschütteten, und dass
man nicht einsehe, wie die Körner an Ort und Stelle kämen.
Neuerlich erwiedert Treviranus, die chemische
Beschaffenheit ändere sich bei der Entwickelung, und die
Membran der Zellen, woraus die Körner gekommen, könne
resorbirt werden, oder auf andere Weise verschwinden.
Er hält also den Ursprung aus Körnern für wahrscheiu-
«iui
Ii!
Kijr
I t H.ii
AÌ i'!