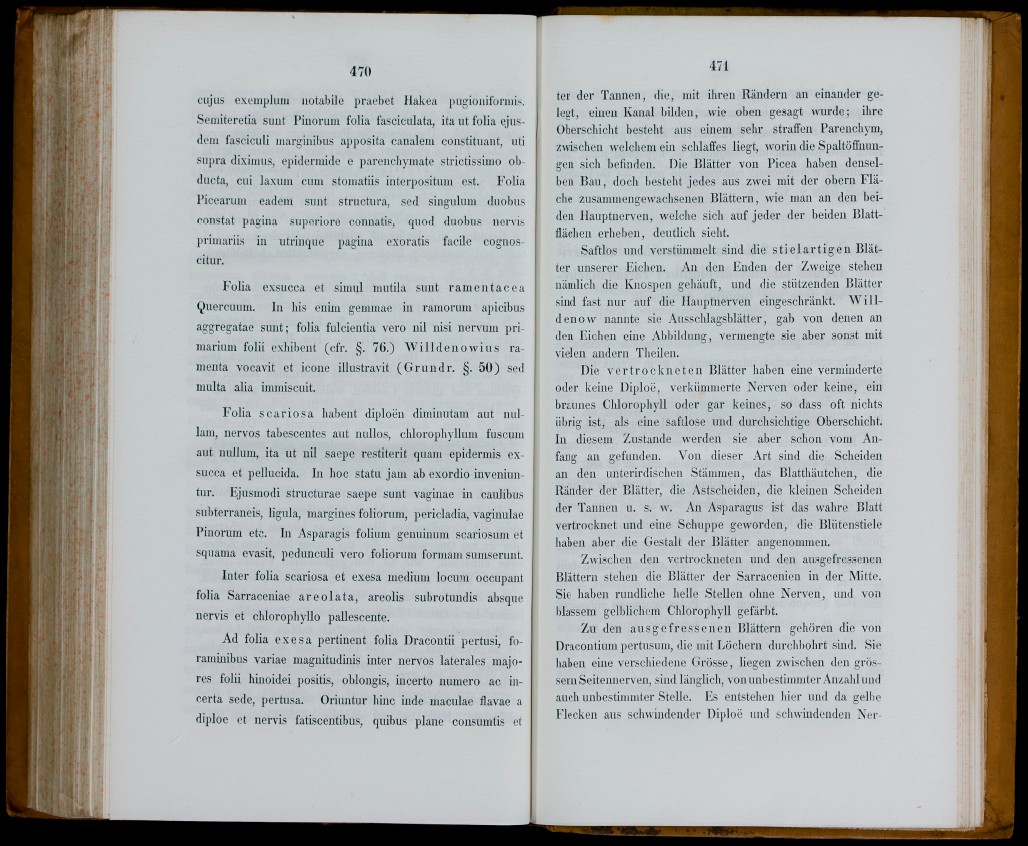
r
r
f ,
; .r:./^
i :
•
. , '
< {
I
1
I ; -t •J
•.-'I
J.,..
. ;
J 4
. f
470
cujus exeinpluiii iiotabile praebet Hakea pugiouifonuLs.
Semiteretia sunt Pinorum folia fasciculata, ita ut folia ejusdem
fasciculi marginibus apposita canalem constituant, uti
supra diximus, epidermide o parencliymate strictissimo obducta,
cui laxum cum stomatiis iuterpositum est. Folia
Picearum eadem sunt structura, sed singulum duobus
constat pagina superiore connatis, quod duobus nervis
primariis in utrinqae pagina exoratis facile cognoscitur.
Folia exsucca et simul mutila sunt ramentacea
Quercuum. In his enim gemmae in ramorum apicibus
aggregatae sunt; folia fulcientia vero nil nisi nervum primarium
folii exhibent (cfr. §. 76.) Willdenowius ramenta
vocavit et icone illustravit (Grundr. §. 50) sed
multa alia immiscuit
Folia scariosa habent diploén diminutam aut nullam^
ñervos tabescentes aut nullos, cliloropliyllum fuscum
aut nullum, ita ut nil saepe restiterit quam epidermis exsucca
et pellucida. In hoc statu jam ab exordio inveniuntur.
Ejusmodi structurae saepe sunt vaginae in caulibus
subterraneis, ligula, margines foliorum, pericladia, vaginulae
Pinorum etc. In Asparagis folium genuinum scariosum et
squama evasit, pedunculi vero foliorum formam sumserunt.
Inter folia scariosa et exesa medium locum occupant
folia Sarraceniae ar e o 1 a t a, areolis subrotundis absque
nervis et chlorophyllo pallescente.
Ad folia exesa pertinent folia Dracontii pertusi, foraminibus
variae magnitudinis inter ñervos laterales majores
folii hinoidei positis, oblongis, incerto immero ac incerta
sede, pertusa. Oriuntur hinc inde maculae flavae a
diploe et nervis fatiscentibus, quibus plane consumtis et
471
ter der Tannen, die, mit ihren Rändern an einander gelegt,
einen Kanal bilden, wie oben gesagt wurde; ihre
Oberschicht besteht aus einem sehr straffen Parenchym,
zwischen welchem ein schlaffes liegt, worin die Spaltöffnungen
sich befinden. Die Blätter von Picea haben denselben
Bau, doch besteht jedes aus zwei mit der obern Eläche
zusammengewachsenen Blättern, wie man an den beiden
Ilauptnerven, welche sich auf jeder der beiden Blattflächen
erheben, deutlich sieht.
Saftlos und verstümmelt sind die stiel a r t i g e n Blätter
unserer Eichen. An den Enden der Zweige stehen
nämlich die Knospen gehäuft, und die stützenden Blätter
sind fast nur auf die Hauptnerven eingeschränkt. Willd
e n ow nannte sie Ausschlagsblätter, gab von denen an
den Eichen eine Abbildung, vermengte sie aber sonst mit
vielen andern Theilen.
Die vertrockneten Blätter haben eine vernnnderte
oder keine Diploe, verkümmerte Nerven oder keine, ein
braunes Chlorophyll oder gar keines, so dass oft nichts
übrig ist, als eine saftlose und durchsichtige Oberschicht.
In diesem Zustande werden sie aber schon vom Anfang
an gefunden. Von dieser Art sind die Scheiden
an den unterirdischen Stämmen, das Blatthäutchen, die
Ränder der Blätter, die Astscheiden, die kleinen Scheiden
der Tannen u. s. w^ An Asparagus ist das wahre Blatt
vertrocknet und eine Schuppe geworden, die Blütenstiele
haben aber die Gestalt der Blätter angenommen.
Zwischen den vertrockneten und den ausgefressenen
Blättern stehen die Blätter der Sarracenien in der Mitte.
Sie haben rundliche helle Stellen ohne Nerven, und von
blassem gelblichem Chlorophyll gefärbt.
Zu den ausgefressenen Blättern gehören die von
Dracontium pertusum, die mit Löchern durchbohrt sind. Sie
haben eine verschiedene Grösse, liegen zwischen den grössern
Seitennerven, sind länglich, von unbestimmter Anzahl und
auch unbestimmter Stelle. Es entstehen hier und da gelbe
Flecken aus schwindender Diploe und schwindenden Ner