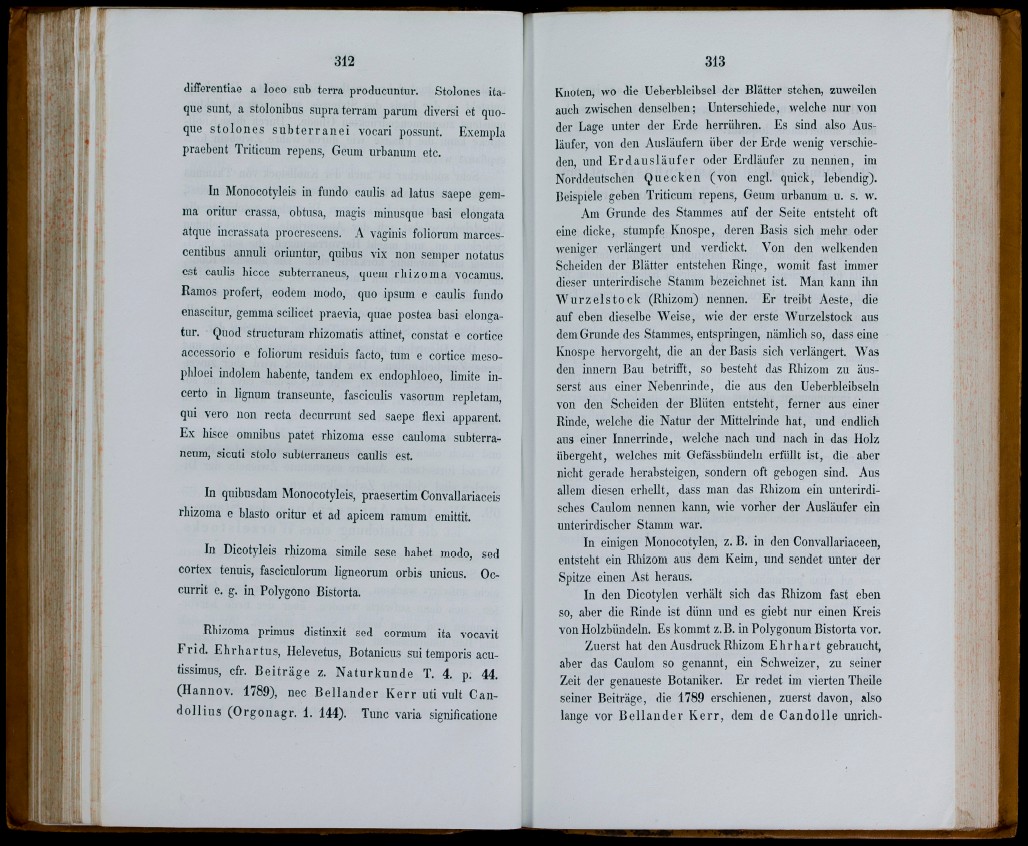
•
»
i.
i' .
J '
i'
f
' Í
312
differentiae a loco sub terra producuntur. Stolones itaque
sunt, a stolonibus supra terram parum diversi et quoque
stolones subterranei vocari possunt. Exempla
praebent Triticum repens, Geum urbanum etc.
In Monocotyleis in fundo caulis ad latus saepe gemma
oritur crassa, obtusa, magis minusque basi elongata
atque incrassata procrescens. A vaginis foliorum marcescentibus
annuii oriuntur, quibus vix non semper notatus
est caulis hicce subterraneus, quera rhizoma vocamus,
Ramos profert, eodem modo, quo ipsum e caulis fundo
enascitur, gemma scilicet praevia, quae postea basi elongatur.
Quod structuram rhizomatis attinet, constat e cortice
accessorio e foliorum residuis facto, tum e cortice mesophloei
indolem habente, tandem ex endophloeo, limite incerto
in lignum transeunte, fasciculis vasorum repletara,
qui vero non recta decurrunt sed saepe flexi apparent.
Ex bisce omnibus patet rhizoma esse cauloma subterraneum,
sicuti stolo subterraneus caulis est.
In quibusdam Monocotyleis, praesertim Convallariaceis
rhizoma e blasto oritur et ad apicem ramum emittit.
In Dicotyleis rhizoma simile sese habet modo, sed
cortex tenuis, fasciculorum ligneorum orbis unicus. Occurrit
e. g. in Polygono Bistorta.
Rhizoma primus distinxit sed cormum ita vocavit
Frid. Ehrh a r tus, Helevetus, Botanicus sui temporis acutissimus,
cfr. Beiträge z. Naturkunde T. 4. p. 44.
(Hannov. 1789), nec Bellander Kerr uti vult Can^
d o l l i u s (Orgonagr. 1, 144). Tunc varia significatione
313
Knoten, wo die Ueberbleibsel der Blätter stehen, zuweilen
auch zwischen denselben; Unterschiede, welche nur von
der Lage unter der Erde herrühren. Es sind also Ausläufer,
von den Ausläufern über der Erde wenig verschieden,
und Erdausläufer oder Erdläufer zu nennen, im
Norddeutschen Quecken (von engl, quick, lebendig).
Beispiele geben Triticum repens, Geum urbanum u. s. w.
Am Grunde des Stammes auf der Seite entsteht oft
eine dicke, stumpfe Knospe, deren Basis sich mehr oder
weniger verlängert und verdickt. Von den v^^elkenden
Scheiden der Blätter entstehen Ringe, womit fast immer
dieser unterirdische Stamm bezeichnet ist. Man kann ihn
W u r z e l s t o c k (Rhizom) nennen. Er treibt Aeste, die
auf eben dieselbe Weise, wie der erste Wurzelstock aus
dem Grunde des Stammes, entspringen, nämlich so, dass eine
Knospe hervorgeht, die an ¿er Basis sich verlängert. Was
den innern Bau betrifft, so besteht das Rhizom zu äusserst
aus einer Nebenrinde, die aus den Ueberbleibseln
von den Scheiden der Blüten entsteht, ferner aus einer
Rinde, welche die Natur der Mittelrinde hat, und endlich
aus einer Innerrinde, welche nach und nach in das Holz
übergeht, welches mit Gefässbündeln erfüllt ist, die aber
nicht gerade herabsteigen, sondern oft gebogen sind. Aus
allem diesen erhellt, dass man das Rhizom ein unterirdisches
Caulom nennen kann, wie vorher der Ausläufer ein
unterirdischer Stamm war.
In einigen Monocotylen, z. B. in den Convallariaceen,
entsteht ein Rhizom aus dem Keim, und sendet unter der
Spitze einen Ast heraus.
In den Dicotylen verhält sich das Rhizom fast eben
so, aber die Rinde ist dünn und es giebt nur einen Kreis
von Holzbündeln. Es kommt z.B. in Polygonum Bistorta vor.
Zuerst hat den Ausdruck Rhizom Ehrha r t gebraucht,
aber das Caulom so genannt, ein Schweizer, zu seiner
Zeit der genaueste Botaniker. Er redet im vierten Theile
seiner Beiträge, die 1789 erschienen, zuerst davon, also
lange vor Bellander Kerr, dem de Candolle unrich-^
Yf
.