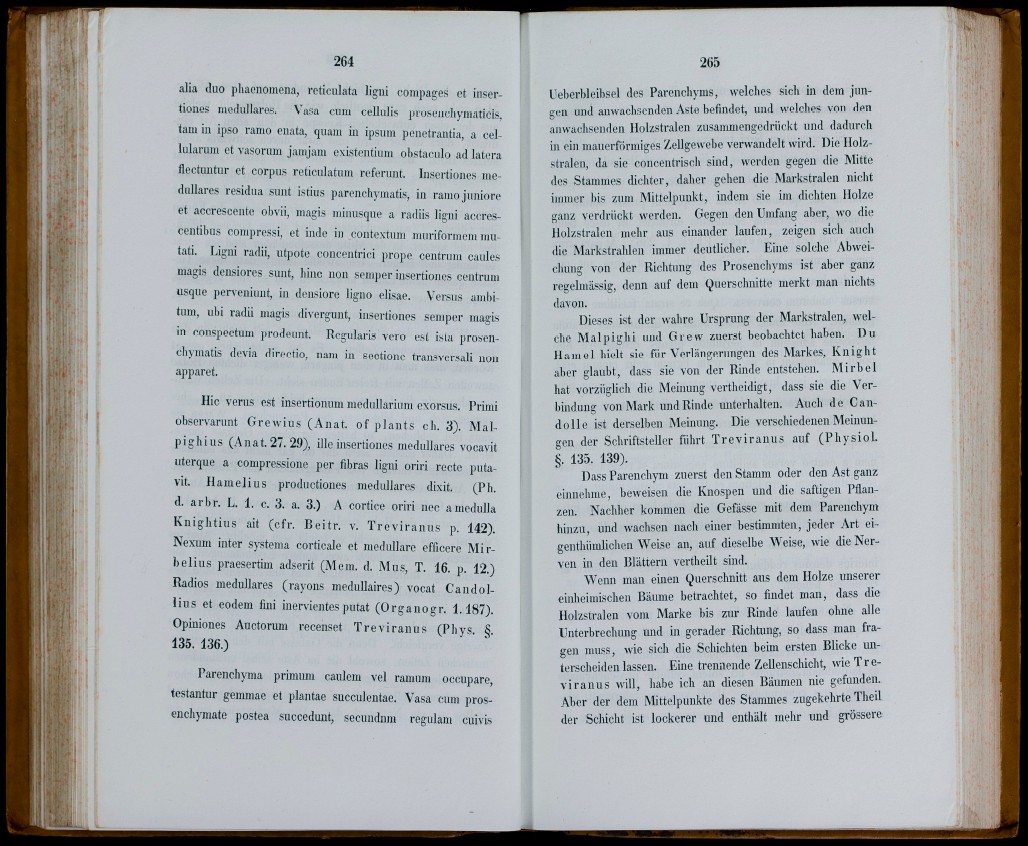
"'i'T^iiir''
lif'
'.Life
f''
, r . it h • ;
r ,-"4,
V I > uB "unn*
• • • •• ,
- i l :
«
i K
. • - ' ^ -i*" f 1 ' •
'' . ' . - ' ' '
'I-
•i ^ . ' ' 1
ii " .v;
ii-';:-.
m 4 •
Í^^ -,' •f
f vi .-•.
- ' «
¡H :
i i
' Í
: » Í • -T. 1 ^ • ii'
if
1 ' lif,
« t
il
264
alia duo pliaenoinena, reticulata ligiii compages et insertiones
medulläres. Vasa cum cellulis prosenchymaticis,
tam in ipso ramo enata, quam in ipsum penetrantiii, a cellularum
et vasorum jamjam existentium obstáculo ad latera
flectuntur et corpus reticulatum referunt. Insertiones medulläres
residua sunt istius parenchymatis, in ramo juniore
et accrescente obvii, magis minusque a radiis ligni accrescentibus
compressi, et inde in contextum muriformem mutati.
Ligni radii, utpote concentrici prope centrum caules
magis densiores sunt, hinc non semper insertiones centrum
usque perveniunt, in densiore ligno elisae. Versus ambitum,
ubi radii magis divergunt, insertiones semper magis
in conspectum prodeunt. Regularis vero est ista prosencliymatis
devia directio, nam in sectione transversali non
apparet.
Hie verus est insertionum medullarium exorsus. Primi
observarunt Grewius (Anat. of plants cli. 3). MaL
p i g h i u s (Anat. 27. 29), ille insertiones medulläres vocavit
uterque a compressione per fibras ligni oriri recte putavit.
Hamelius productiones medulläres dixit. (Ph.
d. arbr. L. 1. c. 3. a. 3.) A cortice oriri nec a medulla
Knightius ait (cfr. Beitr. v. Treviranus p. 142).
Nexum inter systema corticale et medulläre efficere Mirbelius
praesertim adserit (Mem. d. Mus, T. 16. p. 12.)
Radios medulläres (rayons medullaires) vocat Can do 1-
l i u s et eodem fini inervientesputat (Organogr. 1.187).
Opiniones Auctorum recenset Treviranus (Pliys. §.
135. 136.)
Parenchyma primum caulem vel ramum occupare,
testantur gemmae et plantae succulentae. Vasa cum prosenchymate
postea succedunt, secundnm regulam cuivis
265
Ueberbleibsel des Parenchyms, welches sich in dem jungen
und anwachsenden Aste befindet, und welches von den
anwachsenden Holzstralen zusammengedrückt und dadurch
in ein mauerförmiges Zellgewebe verwandelt wird. Die Holzstralen,
da sie concentrisch sind, werden gegen die Mitte
des Stammes dichter, daher gehen die Markstralen nicht
immer bis zum Mittelpunkt, indem sie im dichten Holze
ganz verdrückt werden. Gegen den Umfang aber, wo die
Holzstralen mehr aus einander laufen, zeigen sich auch
die Markstrahlen immer deutlicher. Eine solche Abweichung
von der Richtimg des Prosenchyms ist aber ganz
regelmässig, denn auf dem Querschnitte merkt man nichts
davon.
Dieses ist der wahre Ursprung der Markstralen, welche
Malpighi und Grew zuerst beobachtet haben. Du
Hamel hielt sie für Verlängerungen des Markes, Knight
aber glaubt, dass sie von der Rinde entstehen. Mirbel
hat vorzüglich die Meinung vertheidigt, dass sie die Verbindung
von Mark und Rinde unterhalten. Auch de Cand
o l l e ist derselben Meinung. Die verschiedenen Meinungen
der Schriftsteller führt Treviranus auf (Physiol.
§. 135. 139).
Dass Parenchym zuerst den Stamm oder den Ast ganz
eiimehme, beweisen die Knospen und die saftigen Pflanzen.
Nachher kommen die Gefässe mit dem Parenchym
hinzu, und wachsen nach einer bestimmten, jeder Art eigenthümlichen
Weise an, auf dieselbe Weise, wie die Nerven
in den Blättern vertheilt sind.
Wenn man einen Querschnitt aus dem Holze unserer
einheimischen Bäume betrachtet, so findet man, dass die
Holzstralen vom Marke bis zur Rinde laufen ohne alle
Unterbrechung und in gerader Richtung, so dass man fragen
muss, wie sich die Schichten beim ersten Blicke unterscheiden
lassen. Eine trennende Zellenschicht, wie Trev
i r a n u s will, habe ich an diesen Bäumen nie gefunden.
Aber der dem Mittelpunkte des Stammes zugekehrte Theil
der Schicht ist lockerer und enthält mehr und grössere
Am'-.i
'
I ••(
I f