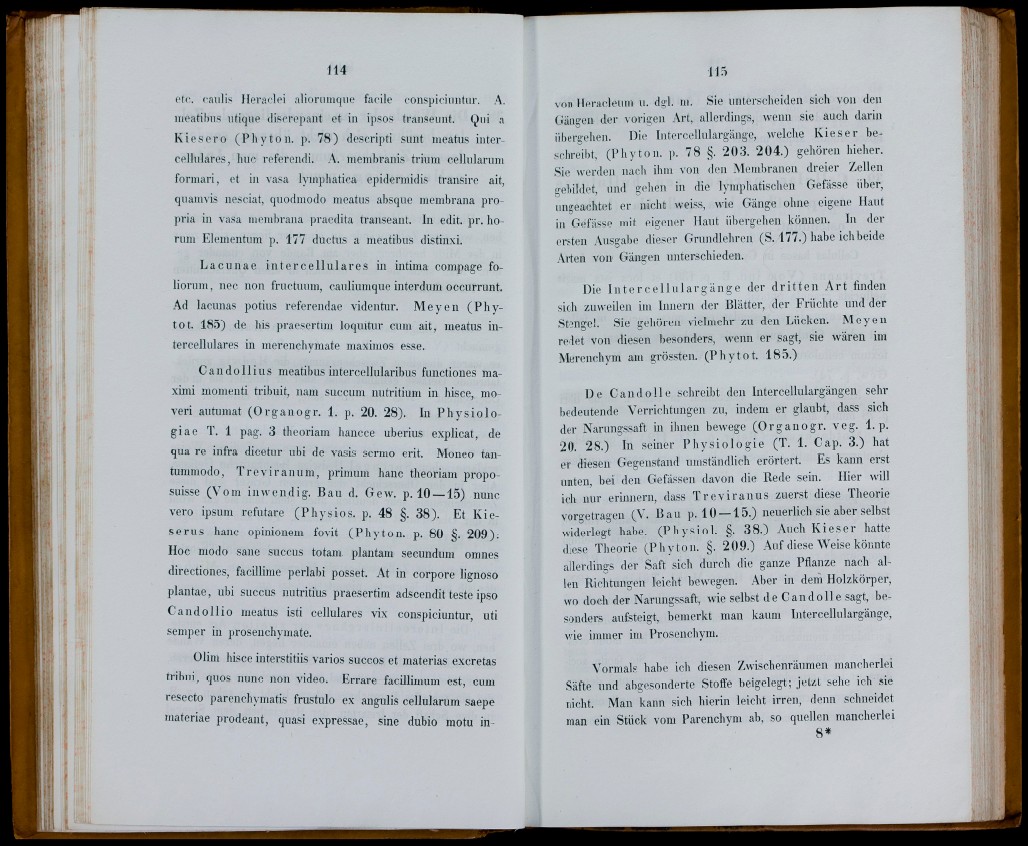
1•.!•' "i';
L... Vie
í: •• •-•
iíMt.-
h i J - " • ài
c " •
,. 4 J::
"II '
yí
.U'.Ti
¿T1. ÄlÜ)
' "I
I ]
3 ^ !Í
'1
.4
i^F
ii If
• í • .1
1
-fii
i::'
íji i i
Jii: s
i l i
•i1
iri:
íJif!'
ti
fi!
^ ifll
^ I
lili!!
Jriu :
114
(Me. caulis Heraclei aliornnique facile eonspiciiintur. A.
iiioatibns ufique discrepant et in ipsos transeunt. Qui a
K i e s e r o (Phyton, p. 78 ) descripti sunt meatus intercellulares,
hue referendi. A. membranis trium cellularuni
forniari, et in vasa lyniphatica epidermidis transiré ait,
quanivis nesciat, quodmodo meatus absque membrana propria
in vasa membrana praedita transeant. In edit. pr. horum
Elementum p. 177 ductus a meatibus distinxi.
L a c u n a e intercellulares in intima compage foliorum,
nec non fructuum, canlinmque interdum occurrunt.
Ad lacunas potius referendae videntur. Meyen (Phytot.
185) de his praesertim loquitur cum ait, meatus intercellulares
in merenchymate máximos esse.
Can do 11 i n s meatibus intercellularibus functiones maximi
momenti tribuit, nam succum nutritium in hisce, moveri
autumat (Organogr. 1. p. 20. 28). In Physiolog
i a e T. 1 pag. 3 theoriam hancce uberius explicat, de
qua re infra dicetur ubi de vasis sermo erit. Moneo tantummodo,
Treviranum, primum hanc theoriam proposuisse
(Vom inwendig. Bau d. Gew. p. 10 —15) nunc
vero ipsum refutare (Physios, p. 48 §. 38). Et Kies
e r u s hanc opinionem fovit (Phyton, p. 80 §. 209):
Hoc modo sane succus totam. plantam secundum omnes
directiones, facillime perlabi posset. At in corpore lignoso
plantae, ubi succus nutritius praesertim adscendit teste ipso
C a nd oil io meatus isti cellulares vix conspiciuntur, uti
semper in prosenchymate.
Olim hisce interstitiis varios suecos et materias excretas
tribui, quos nunc non video. Errare facillimum est, cum
resecto parenchymatis frustulo ex angulis cellularum saepe
materiae prodeant, quasi expressae, sine dubio motu in--
115
von Ileracleuni u. dgl. m. Sie unterscheiden sich von den
Gängen der vorigen Art, allerdings, wenn sie auch darin
übergehen. Die Intercellulargänge, welche Kieser beschreibt,
(Phyton, p. 78 §. 203. 204.) gehören hieher.
Sie werden nach ihm von den Membranen dreier Zellen
gel>i!det, luid gehen in die lympliatischen Gefässe über,
ungeachtet er nicht weiss, wie Gänge ohne eigene Haut
in Gefässe mit eigener Haut übergehen können. In der
ersten Ausgabe dieser Grundlehren (S. 177.) habe ich beide
Arten von Gängen unterschieden.
Die Int e r c e l lul a rgänge der dri t ten Art finden
sich zuweilen im Innern der Blätter, der Früchte und der
Stengel. Sie gehören vielmehr zu den Lücken. Meyen
redet von diesen besonders, wenn er sagt, sie wären im
Merenchym am grössten. (Phytot. 185.)
De C a n d o l l e schreibt den Intercellulargängen sehr
bedeutende Verrichtungen zu, indem er glaubt, dass sich
der Narungssaft in ihnen bewege (Organogr. veg. 1. p.
20. 28.) In seiner Physiologie (T. 1. Cap. 3.) hat
er diesen Gegenstand umständlich erörtert. Es kann erst
unten, bei den Gefässen davon die Rede sein. Hier will
ich nur erinnern, dass Trevi ranus zuerst diese Theorie
vorgetragen (V. Bau p. 10 —15. ) neuerlich sie aber selbst
widerlegt habe. (Physiol. §. 38.) Auch Kies er hatte
diese Theorie (Phyton. §. 209.) Auf diese Weise könnte
allerdings der Saft sich durch die ganze Pflanze nach allen
Richtungen leicht bewegen. Aber in dem Holzkörper,
wo doch der Narungssaft, wie selbst de C andol l e sagt, besonders
aufsteigt, bemerkt man kaum Intercellulargänge,
wie immer im Prosenchym.
Vormals habe ich diesen Zwischenräumen mancherlei
Säfte und abgesonderte Stoffe beigelegt; jetzt sehe ich sie
nicht. Man kann sich hierin leicht irren, denn schneidet
man ein Stück vom Parenchym ab, so quellen mancherlei
8 *
IP'.-ii' l
A
ti IH
IH'
m
•'•HUtìl
" ^ il
, i
•íWííi
i^lii-; ^
<^ MI
'i.
II t\\,« 1