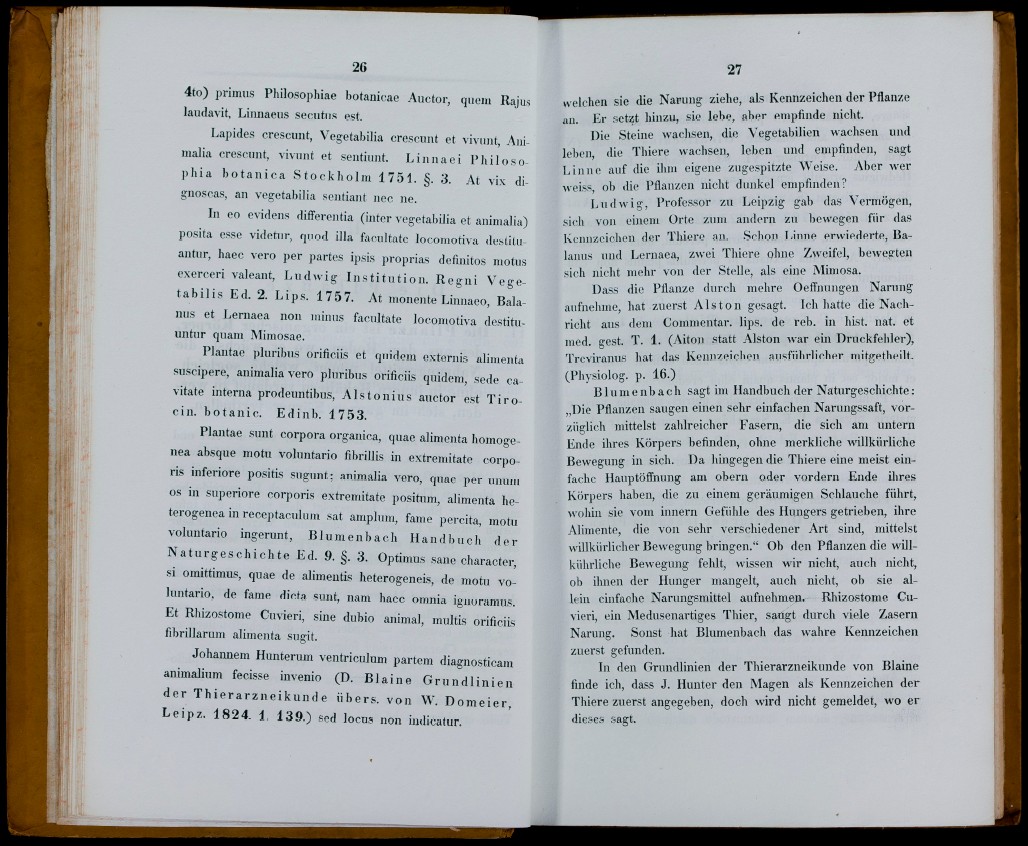
i aw
' I j' '
! •
; •
. ; i:!'
' 'J. bill > • '
I •
-l'i!
:!'!! i
i:s' i.1 ' A
26
4to) primus Philosophiae botanicae Auctor, queiii Rajus
laudavit, Linnaeus secutus est.
Lapides crescunt, Vegetabilia crescunt et vivant, Animalia
crescunt, vivant et sentiunt. Linnaei Phil o Sop
h i a botanica Stockholm 1751. §. 3. At vix dignoscas,
an vegetabilia sentiant nee ne.
In eo evidens differentia (inter vegetabilia et ammalia)
posita esse videtur, quod ilia facúltate locomotiva destituanüir,
haec vero per partes ipsis proprias definitos motus
exerceri valeant, Ludwig Institution. Regni Veget
a b i l i s Ed. 2. Lips. 1757. At monente Linnaeo, Baianus
et Lernaea non minus facúltate locomotiva destituuntur
quam Mimosae.
Plantae pluribus orificiis et quidem externis alimenta
suscipere, animalia vero pluribus orificiis quidem, sede cavitate
interna prodeuntibus, Alstonius auctor est Tirocin.
botanic. Edinb. 1753.
Plantae sunt corpora organica, quae alimenta homogénea
absque motu voluntario ñbrillis in extremitate corporis
inferiore positis sugunt; animalia vero, quae per unum
os in superiore corporis extremitate positum, alimenta heterogenea
in receptaculum sat amplum, fame percita, motu
voluntario ingerunt, Blumen b a c h Handbuch der
N a t u r g e s c h i c h t e Ed. 9. §. 3. Optimus sane character,
si omittimus, quae de alimentis heterogeneis, de motu voluntario,
de fame dicta sunt, nam haec omnia ignoramus.
Et Rhizostome Cuvieri, sine dubio animal, multis orificiis
fibrillarum alimenta sugit.
Johannem Hunterum ventriculum partem diagnosticara
animalium fecisse invenio (D. Blaine Grundlinien
d e r Thierarzneikunde übers, von W. Domeier
L e i p z . 1824. 1. 139.) sed locus non indicatur.
27
welchen sie die Narung ziehe, als Kennzeichen der Pflanze
an. Er setzt hinzu, sie lebe, aber empfinde nicht.
Die Steine wachsen, die Vegetabilien wachsen und
leben, die Thiere wachsen, leben und empfinden, sagt
Linne auf die ihm eigene zugespitzte Weise. Aber wer
weiss, ob die Pflanzen nicht dunkel empfinden?
L u d w i g , Professor zu Leipzig gab das Vermögen,
sich von einem Orte zum andern zu bewegen für das
Kennzeichen der Thiere an. Schon Linne erwiederte, Baianus
und Lernaea, zwei Thiere ohne Zweifel, bewegten
sich nicht mehr von der Stelle, als eine Mimosa.
Dass die Pflanze durch mehre Oefl'nungen Narung
aufnehme, hat zuerst Ai s ton gesagt. Ich hatte die Nachricht
aus dem Commentar. lips, de reb. in hist. nat. et
med. gest. T. 1. (Aiton statt Aiston war ein Druckfehler),
Treviranus hat das Kennzeichen ausführlicher mitgetheilt.
(Physiolog. p. 16.)
B l u m e n b a c h sagt im Handbuch der Naturgeschichte:
„Die Pflanzen saugen einen sehr einfachen Narungssaft, vorzüglich
mittelst zahlreicher Fasern, die sich am untern
Ende ihres Körpers befinden, ohne merkliche willkürliche
Bewegung in sich. Da hingegen die Thiere eine meist einfache
Hauptöffnung am obern oder vordem Ende ihres
Körpers haben, die zu einem geräumigen Schlauche führt,
wohin sie vom innern Gefühle des Hungers getrieben, ihre
Alimente, die von sehr verschiedener Art sind, mittelst
willkürlicher Bewegung bringen." Ob den Pflanzen die willkührliche
Bewegung felüt, wissen wir nicht, auch nicht,
ob ihnen der Hunger mangelt, auch nicht, ob sie allein
einfache Narungsmittel aufnehmen.- Rhizostome Cuvieri,
ein Medusenartiges Thier, satígt durch viele Zasern
Narung. Sonst hat Blumenbach das wahre Kennzeichen
zuerst gefunden.
In den Grundlinien der Thierarzneikunde von Blaine
finde ich, dass J. Hunter den Magen als Kennzeichen der
Thiere zuerst angegeben, doch wird nicht gemeldet, wo er
dieses sagt.