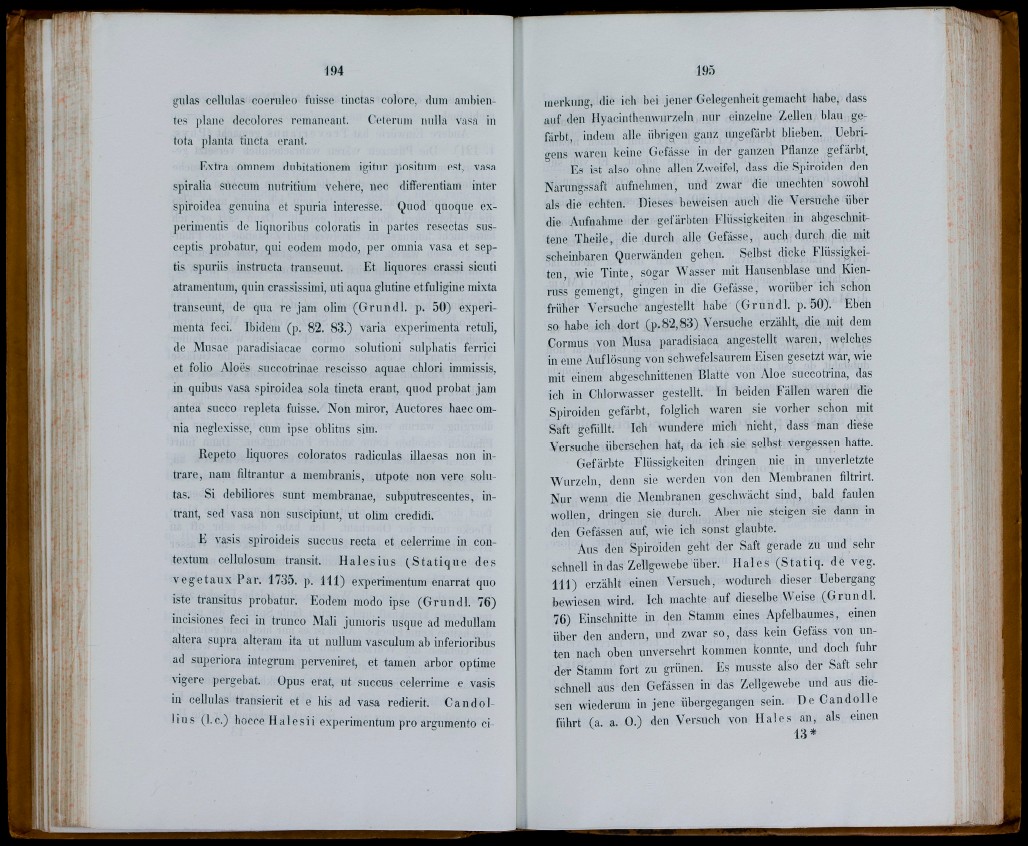
mI - :
.f ,'i
^ ;
11
v' : 1
r
i*. t -
r < 1 ' " '
N ' i i l ? ^
194
gulas cellulas coeruleo i'uisse rinctas colore, diim ambientes
plane decolores reniíinoant. Celemín milla vasa in
tota planta tincta erant.
Extra omneni dubitationem igitnr positnm est, vasa
spiralia snccnra niitritium veliere, nec differentiam ínter
spiroidea genuina et spuria interesse. Quod quoque experinientis
de liqnoribus coloratis in partes resectas susceptis
probatur, qui eodem modo, per omnia vasa et septis
spuriis instructa transeuut. Et liquores crassi sicuti
atramentum, quin crassissimi, uti aqua glutine etfuligine mixta
transenni, de qua re jam olim (Grundl. p. 50) experimenta
feci. Ibidem (p. 82. 83.) varia experimenta retuli,
de Musae paradisiacae cormo solutioni sulphatis ferrici
et folio Aloes succotrinae rescisso aquae chlori immissis,
in quibus vasa spiroidea sola tincta erant, quod probat jam
antea succo repleta fuisse. Non miror, Auctores haec omnia
neglexisse, cum ipse oblitus sim.
Repeto liquores coloratos radiculas illaesas non intrare,
nam filtrantur a membranis, utpote non vere solutas.
Si debiliores sunt membranae, subputrescentes, intrant,
sed vasa non suscipiunt, ut olim credidi.
E vasis spiroideis succus recta et celerrime in contextura
cellulosum transit. Halesius (Statique des
v e g e t a u x Par. 1735. p. I l i ) experimentum enarrai quo
iste transitus probatur. Eodem modo ipse (Grundl. 76)
incisiones feci in trunco Mali jumoris usque ad medullam
altera supra alteram ita ut nullum vasculum ab inferioribus
ad superiora integrum perveniret, et tamen arbor optime
vigere pergebat. Opus erat, ut succus celerrime e vasis
in cellulas transient et e Ms ad vasa redierit. Candoll
i u s (l.c.) bocce Hales i i experimentum pro argumento ci-
195
irierkung, die ich bei jener Gelegenheit gemacht habe, dass
auf den Hyacinthenwurzeln nur einzelne Zellen blau gefärbt,
indem alle übrigen ganz luigefärbt blieben. Uebrigens
waren keine Gefässe in der ganzen Pflanze gefärbt.
Es ist also ohne allen Zweifel, dass die Spiroiden den
Narungssaft aufnehmen, und zwar die unechten sowohl
als die echten. Dieses beweisen auch die Versuche über
die Aufnahme der gefärbten Flüssigkeiten in abgeschnittene
Theile, die durch alle Gefässe, auch durch die mit
scheinbaren Querwänden gehen. Selbst dicke Flüssigkeiten,
wie Tinte, sogar Wasser mit Hausenblase und Kienruss
gemengt, gingen in die Gefässe, worüber ich schon
früher Versuche angestellt habe (Grundl. p. 50). Eben
so habe ich dort (p.82,83) Versuche erzählt, die mit dem
Cormus von Musa paradisiaca angestellt waren, welches
in eme Auflösung von schwefelsaurem Eisen gesetzt war, wie
mit einem abgeschnittenen Blatte von Aloe succotrina, das
ich in Chlorwasser gestellt. In beiden Fällen waren die
Spiroiden gefärbt, folglich waren sie vorher schon mit
Saft gefüllt. Ich wundere mich nicht, dass man diese
Versuche übersehen hat, da ich sie selbst vergessen hatte.
Gefärbte Flüssigkeiten dringen nie in unverletzte
Wurzeln, denn sie werden von den Membranen filtrirt.
Nur wenn die Membranen geschwächt sind, bald faulen
wollen, dringen sie durch. Aber nie steigen sie dann in
den Gefässen auf, wie ich sonst glaubte.
Aus den Spiroiden geht der Saft gerade zu und sehr
schnell in das Zellgewebe über. Haies (Statiq. de veg.
I I I ) erzählt einen Versuch, wodurch dieser Uebergang
bewiesen wird. Ich machte auf dieselbe Weise (Grundl.
76) Einschnitte in den Stamm eines Apfelbaumes, einen
über den andern, und zwar so, dass kein Gefäss von unten
nach oben unversehrt kommen konnte, und doch fuhr
der Stamm fort zu grünen. Es musste also der Saft sehr
schnell aus den Gefässen in das Zellgewebe und aus diesen
wiederum in jene übergegangen sein. De Candolle
führt (a. a. O.) den Versuch von Haies an, als emen
13*
Fl : • (