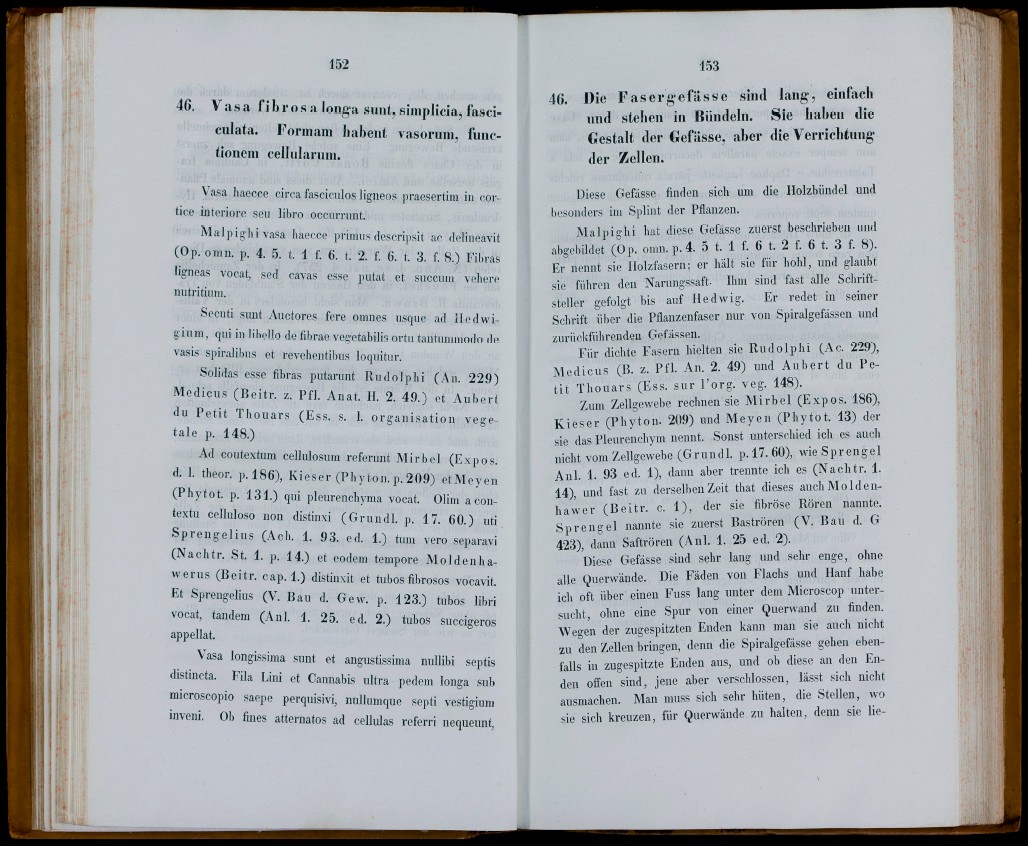
t
2
•t.
152
4Ö. V a s a f i b r o s a longa sunt, Simplicia, fasci
e n l a t a . Formarn liabent vasorum, funetioneni
cellnlarnm.
Vasa haecce circa fasciciilos ligneos praesertim in cortice
interiore sen libro occnrrant.
Malpighivasa haecce primus descripsit ac delineavit
(Op. omn. p. 4. 5. t. 1 f. 6. t. 2. f. 6. t. 3. f. 8.) Fibras
ligneas vocat, sed cavas esse putat et succnm veliere
nutritinm.
Secnti sunt Auctores fere omnes usque ad iledwigium,
qui in libello de fibrae vegetabilis ortu tantummodo de
vasis spiralibus et revehentibus loquitur.
Solidas esse fibras putarunt Rudolphi (An. 229)
Medicus (Beitr. z. Pfl. Anat. H. 2. 49. ) et Aubert
du Petit Thouars (Ess. s. 1. organisation veget
a l e p. 148.)
Ad coutextum cellulosum referunt Mir bel (Expos.
d. 1. theor. p. 186) , Kieser (Pliyton. p. 2 0 9 ) etMeyen
(Phytot. p. 131.) qui pleurenchyma vocat. Olim a contextu
celluioso non distinxi (Grnndl. p. 17. 60.) nti
S p r e n g e l i u s (Ach. 1. 93. ed. 1.) turn vero separavi
(Naclitr. St. 1. p. 14.) et eodem tempore Moldenhawerus
(Beitr. cap. 1.) distinxit et tubos fibrosos vocavit.
Et Sprengelius (V. Bau d. Gew. p. 123.) tubos libri
vocat, tandem (Ani. 1. 25. ed. 2.) tubos succigeros
appellat.
Vasa longissima sunt et angustissima nullibi septis
distincta. Fila Lini et Cannabis ultra pedem longa sub
microscopio saepe perquisivi, nullumque septi vestigium
inveni, Ob fines atternatos ad cellulas referri nequeunt,
153
46. Die Fasergefässe sind lang, einfach
und stehen in Bündeln. Sie haben die
Gestalt der Gefässe, aber die Verrichtung
der Zellen.
Diese Gefässe finden sich um die Holzbündel und
besonders im Splint der Pflanzen.
Malpighi hat diese Gefässe zuerst beschrieben und
abgebildet (Op. omn. p. 4. 5 t. 1 f. 6 t. 2 f. 6 t. 3 f. 8).
Er nennt sie Holzfasern; er hält sie für hohl, und glaubt
sie führen den Narungssaft- Ihm sind fast alle Schriftsteller
gefolgt bis auf Hedwig. Er redet in seiner
Schrift über die Pflanzenfaser nur von Spiralgefässen und
zurückführenden Gefässen.
Für dichte Fasern hielten sie Rudolphi (Ac. 229),
Medicus (B. z. Pfl. An. 2. 49) und Aubert du Pet
i t Thouars (Ess. sur l'org. veg. 148).
Zum Zellgewebe rechnen sie Mi rbel (Expos. 186),
K i e s e r (Phyton. 209) und Meye n (Phytot. 13) der
sie das Pleurenchym nennt. Sonst unterschied ich es auch
nicht vom Zellgewebe (Gründl , p. 17. 60), wie Sprengel
Anl. 1. 93 ed. 1), dann aber trennte ich es (Nachtr. 1.
14), und fast zu derselben Zeit that dieses auch M o 1 d e nha
w e r (Beitr. c. 1), der sie fibröse Rören nannte.
S p r e n g e l nannte sie zuerst Baströren (V. Bau d. G
423), dann Saftrören (Anl. 1. 25 ed. 2).
Diese Gefässe sind sehr lang und sehr enge, ohne
alle Querwände. Die Fäden von Flachs und Hanf habe
ich oft über einen Fuss lang unter dem Microscop untersucht,
ohne eine Spur von einer Querwand zu finden.
Wegen der zugespitzten Enden kann man sie auch nicht
zu den Zellen bringen, denn die Spiralgefässe gehen ebenfalls
in zugespitzte Enden aus, und ob diese an den Enden
offen sind, jene aber verschlossen, lässt sich nicht
ausmachen. Man muss sich sehr hüten, die Stellen, wo
sie sich kreuzen, für Querwände zu halten, denn sie liei
l h f r .
^ - t • • Ii
iV. • i; '
Iff i
ì '
1 í
í :
•1.: "t
f I
i / ' •n r-\ >
'1i ', •,
l
il f
• I , ; : : : , k
. .í.:.'j.A
<: ImUlrt;»
• rV'iSS::
; i,f. • i. f
„ i L . ü r I ^
-• sài. I
E í
í "
i
V ! I