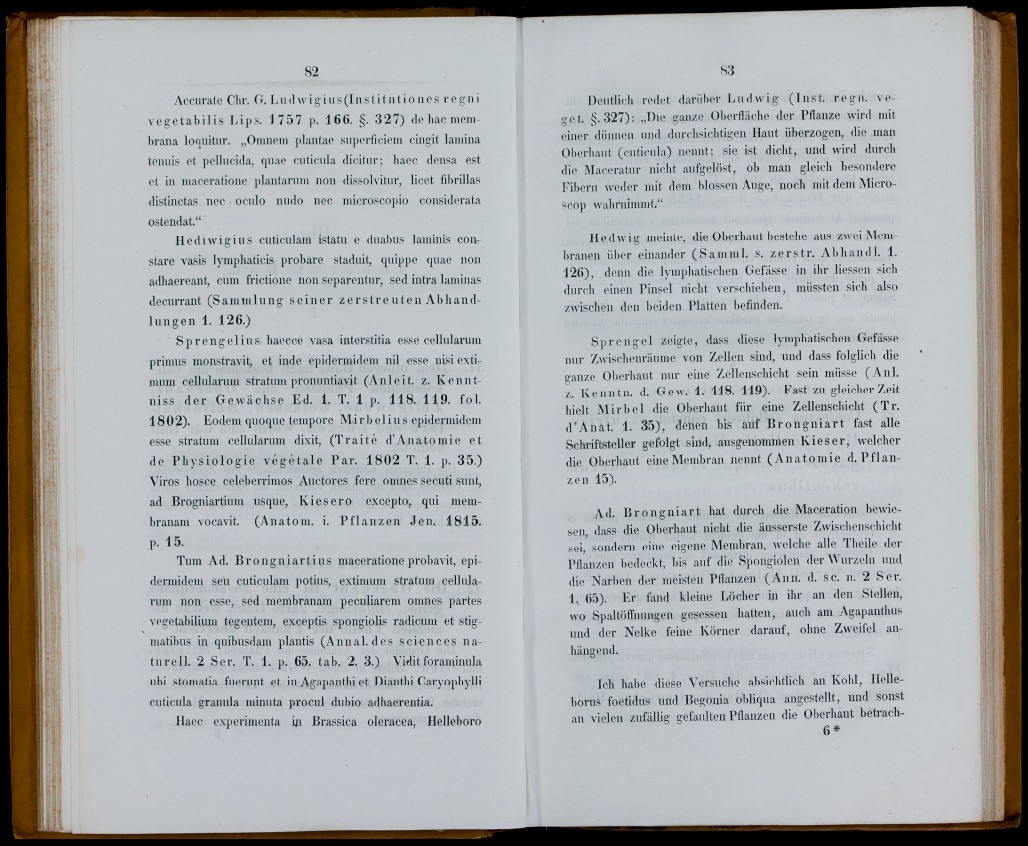
82
't :
IL
-i ;
11
» '
1
a-1 •
J
1"
•Ì,:
Accurate Chr. O. L ii d w i g i u s (I ii s ( i 1 t i o n o s regni
v e g c t a b i l i s Lips. 1 7 5 7 p. 16(). §. 327) <le liac meinhrana
lonuitnr. „Omneni plantae siiperficiem cingit lamina
lemiis et pellucida^ qnae cnticula dicitnr; haec densa est
et in niaceratione plantaruiii non dissolvitur, licet fibrillas
distinctas nec ocnlo nudo nec microscopio considerata
ostendat."
I l e d i w i g i u s cnticulam istatu e duabus laminis constare
vasis lymphaticis probare staduit, quippe quae non
adhaereant, cum frictione non separentnr, sed intra laminas
decurrant (Sammlung seiner zerstreuten Abhandh
i n g e n 1. 126.)
S p r e n g el ins haecce vasa interstitia esse cellularum
prinms monstravit, et inde epidermidem nil esse nisi extimum
cellularum stratum pronuntiavit (Ani e it. z. Kenntniss
der Gewächse Ed. 1. T. 1 p. 118. 119. fol.
1802). Eodem quoque tempore Mirbel ins epidermidem
esse stratum cellularum dixit, (Traité d'Anatomie et
de Physiologie vegetale Par. 1802 T. 1. p. 35.)
Viros hosce celeberrimos Auctores fere omnes secnti sunt,
ad Brogniartium usque, Kies e r o excepto, qui membranam
vocavit. (Anatom, i. Pflanzen Jen. 1815.
p. 15.
Tum Ad. Brongniar t ius maceratione probavit, epidermidem
seu cuticulam potius, extimum stratum cellularum
non esse, sed membranam peculiarem omnes partes
vegetabilium tegentem, exceptis spongiolis radicum et stigmatibus
in quibusdam plantis (Annal. des sciences nat
u r e l l . 2 Ser. T. 1. p. 65. tab. 2. 3.) Viditforaminula
ubi stomatia fuerunt et in Agapanthi et Dianthi Caryopliylli
cuticula granula minuta procul dubio adliaerentia.
ilaec experimenta i^ Brassica oleracea, Helleboro
Deutlich redet darüber Ludwig (Inst. regn. ve--
g-et. §.327): „Die ganze Oberfläche der Pflanze wird mit
(iiner dünnen vind durchsichtigen Haut überzogen, die man
01)erliaut (cuticuhi) nennt; sie ist dicht, und wird durch
die Maceratur niclit aufgelöst, ob man gleich besondere
Fibern weder mit dem blossen Auge, noch mit dem Microscop
wahrnimmt."
Hedwig meinte, die Oberhaut bestehe aus zwei Mem
branen über einander (Samml. s. zerstr, vVbhandl. 1.
126), denn die lymphatischen Gefässe in ihr liessen sicli
durch einen Pinsel nicht verschieben, müssten sich also
zwischen den beiden Platten befinden.
S p r e n g e l zeigte, dass diese lymphatischen Gefässe
nur Z^vischenräume von Zellen sind, und dass folglich die
ganze Oberhaut nur eine Zellenschicht sein müsse (Anl.
z. Kenntn. d. Gew. 1. 118. 119). Fast zu gleicher Zeit
hielt Mir bei die Oberhaut für eine Zellenschicht (Tr.
d ' A n a t . 1. 35), denen bis auf Brongniart fast alle
Schriftsteller gefolgt sind, ausgenommen Kies e r , welcher
die Oberhaut eine Membran nennt (Anatomi e d. P f 1 a nzen
15).
Ad. Brongniart hat durch die Maceration bewiesen,
dass die Oberhaut nicht die äusserste Zwischenschicht
sei, sondern eine eigene Membran, welche alle Theile der
Pflanzen bedeckt, bis auf die Spongiolen der Wurzeln und
die Narben der meisten Pflanzen (Ann. d. sc. n. 2 Ser.
1, 65). Er fand kleine Löcher in ihr an den Stellen,
wo Spaltöffnungen gesessen hatten, auch am Agapanthus
und der Nelke feine Körner darauf, ohne Zweifel anhängend.
Ich habe diese Versuche absichtlich an Kohl, Ilelleborus
foetidus und Begonia obliqua angestellt, und sonst
an vielen zufällig gefaulten Pflanzen die Oberhaut betrach-
6 *
i;
k . I