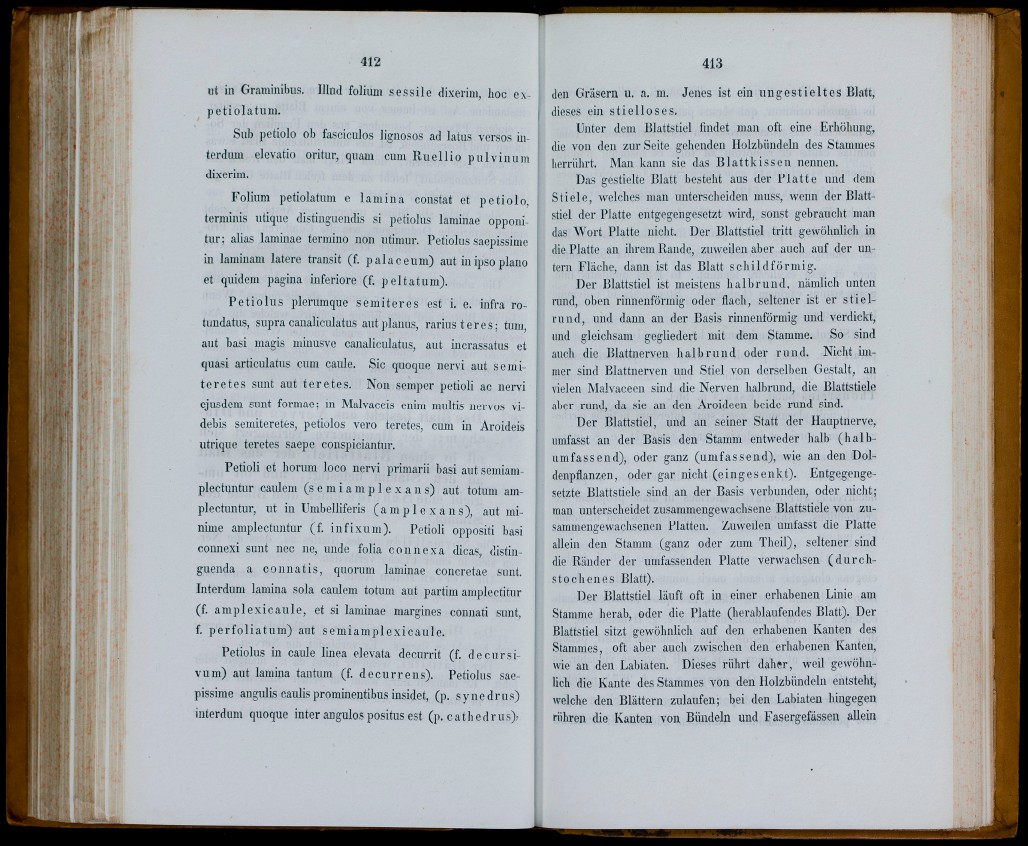
"
'íiv: í»' ' ;
lí -.
» • ;
•* i
•• ;
> Wi i'
ír-»jA '. í. •:' ^'
ä
nr
p.: f "Rr
• í.
r- \
' i
i : "
^ I: ;4 i • ' 'V
¡ . V:• . •»
« I . I
I
412
lú in Graminibus. IJlnd folium sessile dixerim, hoc expetiolatum.
Sub petiolo ob fasciculos lignosos ad latus versos in- :
terdum elevatio oritur, quam cum Ruellio pulvinum '
dixerim.
Folium petiolatum e lamina constat et petiolo, I
terminis utique distinguendis si petiolus laminae opponi- j
tur; alias laminae termino non utimur. Petiolus saepissime ¡
in laminam latere transit (f. palaceum) aut in ipso piano
et quidem pagina inferiore (f. peltatum).
P e t i o l u s plerumque semiteres est i. e. infra rotundatus,
supra canaliculatus aut planus, rarius teres ; turn,
aut basi magis minusve canaliculatus, aut incrassatus et
quasi articulatus cum caule. Sic quoque nervi aut se mit
e r e tes sunt aut teretes. Non semper petioli ac nervi
ejusdem sunt formae; m Malvaceís enim multis ñervos videbis
semiteretès, petiolos vero teretes, cum in Aroideis
ntrique teretes saepe conspiciantur.
Petioli et horum loco nervi primarii basi aut semiamplectuntur
caulem (s e m i a m p 1 e x a n s) aut totum amplectuntur,
ut in Umbelliferis ( ampl e xans) , aut minime
amplectuntur (f, infixum). Petioli oppositi basi
connexi sunt nec ne, unde folia con ne xa dicas, distinguenda
a connatis, quorum laminae concretae sunt.
Interdum lamina sola caulem totum aut partim amplectitur
(f. ampi exicaule, et si laminae margines connati sunt,
f. perfol iatum) aut semiamplexicaule.
Petiolus in caule linea elevata decurrit (f. decursivum)
aut lamina tantum (f. de cur reus). Petiolus saepissime
angulis caulis prominentibus insidet, (p. synedrus)
interdum quoque inter ángulos positus est (p. cathedrus>
413
den Gräsern u. a. m. Jenes ist ein ungest iel tes Blatt,
dieses ein stielloses.
Unter dem Blattstiel findet man oft eine Erhöhung,
die von den zur Seite gehenden Holzbündeln des Stammes
herrührt. Man kann sie das Blattkissen nennen.
Das gestielte Blatt besteht aus der Platte luid dem
Stiele, welches man unterscheiden muss, wenn der Blattstiel
der Platte entgegengesetzt wird, sonst gebraucht man
das Wort Platte nicht. Der Blattstiel tritt gewöhnlich in
die Platte an ihrem Rande, zuweilen aber auch auf der untern
Fläche, dann ist das Blatt schildförmig.
Der Blattstiel ist meistens halbrund, nämlich unten
rund, oben rinnenförmig oder flach, seltener ist er stielrund,
und dann an der Basis rinnenförmig und verdickt,
und gleichsam gegliedert mit dem Stamme. So sind
auch die Blattnerven halbrund oder rund. Nicht immer
sind Blattnerven und Stiel von derselben Gestalt, an
vielen Malvaceen sind die Nerven halbrund, die Blattstiele
aber rund, da sie an den Aroideen beide rund sind.
Der Blattstiel, und an seiner Statt der Hauptnerve,
iimfasst an der Basis den Stamm entweder halb (halbumfassend),
oder ganz (umfassend), wie an den Doldenpflanzen,
oder gar nicht (eingesenkt). Entgegengesetzte
Blattstiele sind an der Basis verbunden, oder nicht;
man unterscheidet zusammengewachsene Blattstiele von zusammengewachsenen
Platten. Zuweilen umfasst die Platte
allein den Stamm (ganz oder zum Theil), seltener sind
die Ränder der umfassenden Platte verwachsen (durchstochenes
Blatt).
Der Blattstiel läuft oft in einer erhabenen Linie am
Stamme herab, oder die Platte (herablaufendes Blatt). Der
Blattstiel sitzt gewöhnlich auf den erhabenen Kanten des
Stammes, oft aber auch zwischen den erhabenen Kanten,
wie an den Labiaten. Dieses rührt daher, weil gewöhnlich
die Kante des Stammes von den Holzbündeln entsteht,
welche den Blättern zulaufen; bei den Labiaten hingegen
rühren die Kanten von Bündeln und Fasergefässen allein