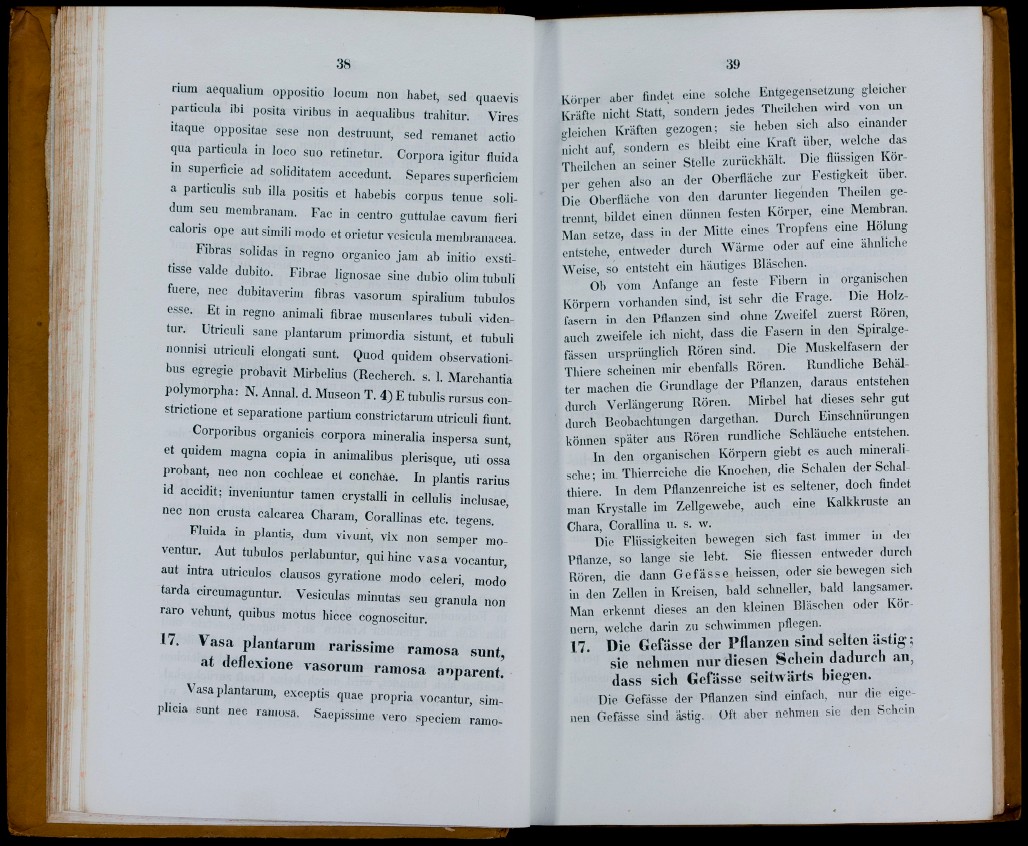
ijmj^
:: !
Í • i'i -'1
ji -;it.'i'- ' ,' I•• M • 1
,1 .••.A ''
? r i ! a
38
rium aequalium oppositio locum non habet, sed quaevis
partícula ibi posita viribus in aequalibus traliitur. Vires
itaque oppositae sese non destruunt, sed remanet actio
qua particula in loco suo retinetur. Corpora igitur fluida
in superficie ad soliditatem accedunt. Separes superficiem
a particulis sub illa positis et habebis corpus tenue solidum
seu membranam. Fac in centro guttulae cavum fieri
caloris ope autsimüimodo et orietur vesicula membranacea.
Fibras solidas in regno organico jam ab initio exstitisse
valde dubito. Fibra<. lignosae sine dubio olim tubuli
fuere, nec dubitaverim fibras vasorum spiralium tubulos
esse. Et in regno animali fibrae musculares tubuli videntur.
Utriculi sane plantarum primordia sistunt, et tubuli
nonnisi utriculi elongati sunt Quod quidem observationibus
egregie probavit Mirbelius (Recherch. s. 1. Marchantía
polymorpha: N. Annal. d. Museon T. 4) E tubulis rursus constrictione
et separatione partium constrictarum utriculi fiunt
Corporibus organicis corpora mineralia inspersa sunt,
et quidem magna copia in animalibus plerisque, uti ossa
probant, nec non cochleae et conchae. In plantis rarius
id accidit; inveniuntur tamen crystalli in cellulis inclusae
nec non crusta calcarea Charam, Corallinas etc. tegens.
Fluida in plantis, dum vivunt, vix non semper moventur.
Aut tubulos perlabuntur, quihinc vasa vocantnr
aut intra utrículos clausos gyratione modo celeri modo
tarda circumaguntur. Vesículas minutas seu granula non
raro vehunt, quibus motus hicce cognoscitnr.
17. Vasa plantarum rarissime ramosa sunt,
at deflexione vasorum ramosa apparent.
Vasa plantarum, exceptis quae propria vocantnr, Simplicia
sunt nec ramosa. Saepissime vero speciem ramo-
39
Körper aber findet eine solche Entgegensetzung gleicher
KräL nicht Statt," sondern jedes Theilchen wird von unoleichen
Kräften gezogen; sie heben sich also einander
nicht auf, sondern es bleibt eine Kraft über wdche das
Theilchen an seiner Stelle zurückhält. Die flussigen Korper
gehen also an der Oberfläche zur Festigkei über.
Die Oberfläche von den darunter liegenden Theilen getrennt
bildet einen dünnen festen Körper, eine Membran.
Man ¡etze, dass in der Mitte eines Tropfens eine Hölung
entstehe, entweder durch Wärme oder auf eme ähnliche
Weise, so entsteht ein häutiges Bläschen.
Ob vom Anfange an feste Fibern in organischen
Körpern vorhanden sind, ist sehr die Frage. Die Holzfasern
in den Pflanzen sind ohne Zweifel zuerst Rören,
auch zweifele ich nicht, dass die Fasern in den Spiralgefässen
ursprünglich Rören sind. Die Muskelfasern der
Thiere scheinen mir ebenfalls Rören. Rundliche Behälter
machen die Grundlage der Pflanzen, daraus entstehen
durch Verlängerung Rören. Mirbel hat dieses sehr gut
durch Beobachtungen dargethan. Durch Einschnürungen
können später aus Rören rundliche Schläuche entstehen.
In den organischen Körpern giebt es auch mmeralische;
im Thierreiche die Knochen, die Schalen der Schalthiere.
In dem Pflanzenreiche ist es seltener, doch findet
man Krystalle im Zellgewebe, auch eine Kalkkruste an
Chara, Corallina n. s. w.
Die Flüssigkeiten bewegen sich fast immer in der
Pflanze, so lange sie lebt. Sie fliessen entweder durch
Rören, die dann Gefässe heissen, oder sie bewegen sich
in den Zellen in Kreisen, bald schneller, bald langsamer.
Man erkennt dieses an den kleinen Bläschen oder Körnern,
welche darin zu schwimmen pflegen.
17. Die Gefässe der Pflanzen sind selten ästig;
sie nehmen nur diesen Schein dadurch an,
dass sich Gefässe seitwärts biegen.
Die Gefässe der Pflanzen sind einfach, nur die eigenen
Gefässe sind ästig. Oft aber nehmen sie den Scheui