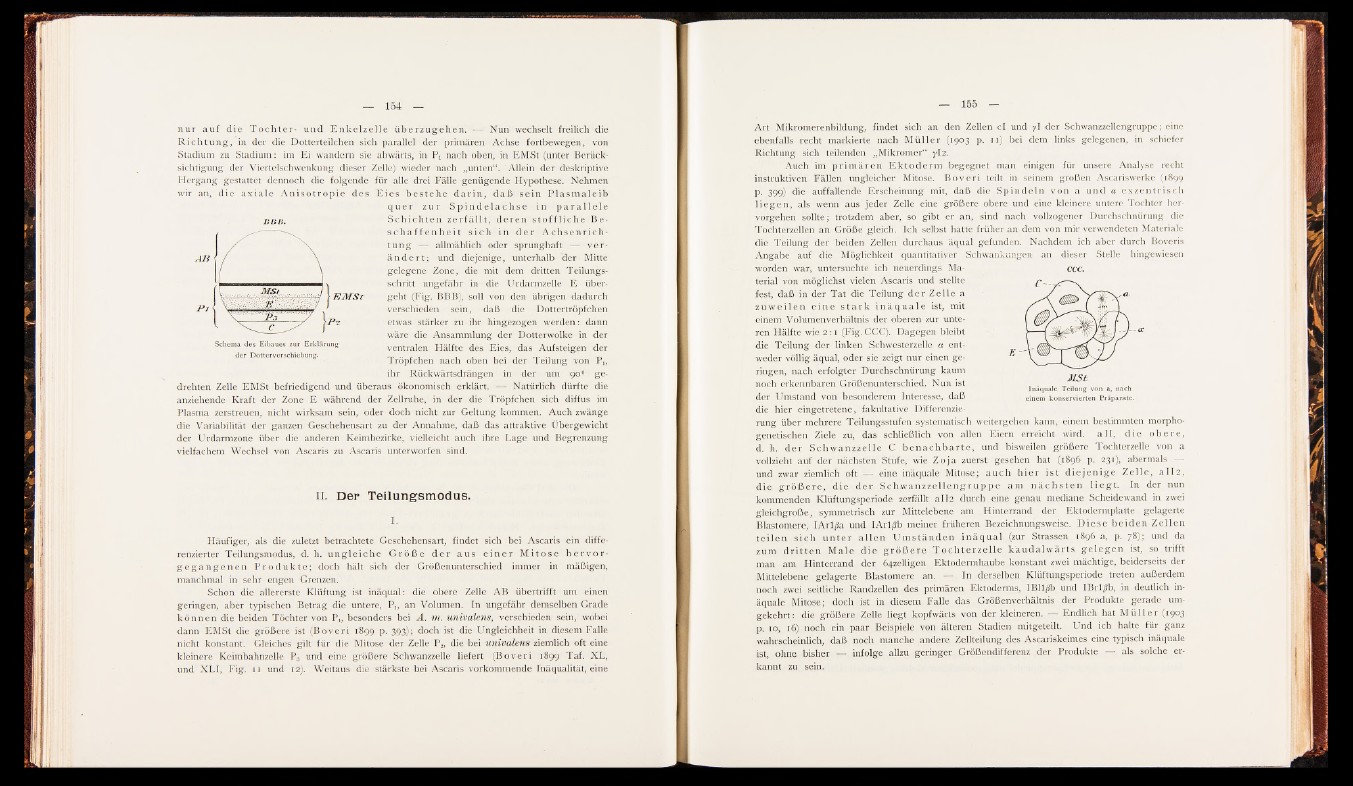
n u r a u f d ie T o c h t e r - u n d E n k e l z e l l e ü b e r z u g e h e n ; — Nun wechselt freilich die
R i c h t u n g , in der die Dotterteilchen sich parallel der primären Achse fortbewegen, von
Stadium zu Stadium: im E i wandern sie abwärts, in P x nach oben, in EM S t (unter Berücksichtigung
der Viertelschwenkung dieser Zelle) wieder nach „unten“ . Allein der deskriptive
Hergang gestattet dennoch die folgende für alle drei Fälle genügende Hypothese. Nehmen
wir an, d ie a x i a l e A n i s o t r o p i e d e s E i e s b e s t e h e d a r in , d a ß s e in P l a sm a l e i b
q u e r z u r S p i n d e l a c h s e in p a r a l l e l e
S c h i c h t e n z e r f ä l l t j d e r e n s t o f f l i c h e B e s
c h a f f e n h e i t s i c h in d e r A c h s e n r i c h t
u n g — allmählich oder sprunghaft e r -
ä n d e r t ; und diejenige, unterhalb der Mitte
gelegene Zone, die mit dem dritten Teilungsschritt
ungefähr in die Urdarmzelle E übergeht
(Fig. BBB), soll von den übrigen dadurch
verschieden sein, daß die Dottertröpfchen
etwas stärker zu ihr hingezogen werden: dann
wäre die Ansammlung der Dotterwolke in der
ventralen Hälfte des Eies, das Aufsteigen der
Tröpfchen nach oben bei der Teilung von Px,
ihr Rückwärtsdrängen in der um 900 g e drehten
im 11.
Schema des Eibaues zur Erklärung
der Dotterverschiebung.
Zelle EM St befriedigend und überaus ökonomisch erklärt. — Natürlich dürfte die
anziehende Kraft der Zone E während der Zellruhe, in der die Tröpfchen sich diffus im
Plasma zerstreuen, nicht wirksam sein, oder doch nicht zur Geltung kommen. Auch zwänge
die Variabilität der ganzen Geschehensart zu der Annahme, daß das attraktive Übergewicht
der Urdarmzone über die anderen Keimbezirke, vielleicht auch ihre La g e und Begrenzung
vielfachem Wechsel von Ascaris zu Ascaris unterworfen sind.
11. Der Teilungsmodus.
1.
Häufiger, als die zuletzt betrachtete Geschehensart, findet sich bei Ascaris ein differenzierter
Teilungsmodus, d. h. u n g l e i c h e G r ö ß e d e r a u s e i n e r M i t o s e h e r v o r g
e g a n g e n e n P r o d u k t e ; doch hält sich der Größenunterschied immer in mäßigen,
manchmal in sehr engen Grenzen.
Schon die allererste K lü ftu n g 1 ist in äqu a l: die obere Zelle A B übertrifft um einen
geringen, aber typischen Betrag die untere, Pj, an Volumen. In ungefähr demselben Grade
k ö n n e n die beiden Töchter von P^ besonders bei A. m. univalens, verschieden sein, wobei
dann EM St die größere ist (B o v e r i 1899 p. 393); doch ist die Ungleichheit in diesem Falle
nicht konstant. Gleiches gilt für die Mitose der Zelle P 2, die bei univalens ziemlich oft eine
kleinere Keimbahnzelle P 3 und eine größere Schwanzzelle liefert (B o v e r i 1899 T ä f. X L ,
und X L I, Fig. 11 und 12). Weitaus die stärkste bei Ascaris vorkommende Inäqualität, eine
A r t Mikromerenbildung, findet sich an den Zellen c l und yl der Schwanzzellengruppe; eine
ebenfalls recht markierte nach M ü l l e r (1903 p. 11) bei dem links gelegenen, in schiefer
Richtung sich teilenden „Mikromer“ yl2.
Auch im p r im ä r e n E k t o d e rm begegnet man einigen für unsere Analyse recht
instruktiven Fällen ungleicher Mitose. B o v e r i teilt in seinem großen Ascariswerke (1899
p. 399) die auffallende Erscheinung mit, daß die S p in d e ln v o n a u n d a e x z e n t r i s c h
l i e g e n , als wenn aus jeder Zelle eine größere obere und eine kleinere untere Tochter hervorgehen
sollte; trotzdem aber, so gibt er an, sind nach vollzogener Durchschnürung die
Tochterzellen an Größe gleich. Ich selbst hatte früher an dem von mir verwendeten Materiale
die Teilung der beiden Zellen durchaus äqual gefunden. Nachdem ich aber durch Boveris
A ngabe auf die Möglichkeit quantitativer Schwankungen an dieser Stelle hingewiesen
worden war, untersuchte ich neuerdings Material
von möglichst vielen Ascaris und stellte
fest, daß in der T a t die Teilung d e r Z e l l e a
z u w e i l e n e in e s t a r k i n ä q u a l e is.t, mit
einem Volumenverhältnis der oberen zur unteren
Hälfte wie 2 :1 (Fig. CCC). Dagegen bleibt
die Teilung der linken Schwesterzelle a entweder
völlig äqual, oder sie zeigt nur einen g e ringen,
nach erfolgter Durchschnürung kaum
noch erkennbaren Größenunterschied. Nun ist
der Umstand von besonderem Interesse, daß
die hier eingetretene, fakultative Differenzierung
über mehrere Teilungsstufen systematisch weitergehen kann, einem bestimmten morpho-
genetischen Ziele zu, das schließlich von allen Eiern erreicht wird, a l l , d i e o b e r e ,
d. h. d e r S c h w a n z z e l l e C b e n a c h b a r t e , und bisweilen größere Tochterzelle von a
vollzieht auf der nächsten Stufe, wie Z o ja zuerst gesehen hat (1896 p. 231), abermals —
und zwar ziemlicli oft — eine inäquale Mitose; a u c h h i e r i s t d i e j e n i g e Z e l l e , a l l 2 ,
d i e g r ö ß e r e , d ie d e r S c h w a n z z e l l e n g r u p p e am n ä c h s t e n l i e g t . In der nun
kommenden Klüftungsperiode zerfällt a l l2 durch eine genau mediane Scheidewand in zwei
g leichgroße, symmetrisch zur Mittelebene am Hinterrand der Ektodermplatte gelagerte
Elastomere, IArl/Ja und IA r lß b meiner früheren Bezeichnungsweise. D i e s e b e id e n Z e l l e n
t e i l e n s i c h u n t e r a l l e n U m s t ä n d e n in ä q u a l (zur Strassen 1896 a, p. 78); und da
zum d r i t t e n M a le d ie . g r ö ß e r e T o c h t e r z e l l e k ä u d a lw ä r t s g e l e g e n ist, so trifft
man am Hinterrand der 64zelligen Ektodermhaube konstant zwei mächtige, beiderseits der
Mittelebene gelagerte Blästomere an.r^ ^ In derselben Klüftungsperiode treten außerdem
noch zwei seitliche Randzellen des primären Ektoderms, IBllßb und IBrl/?b, in deutlich inäquale
Mitose; doch ist in diesem Falle das Größenverhältnis der Produkte gerade umgekehrt:
die größere Zelle liegt kopfwärts von der kleineren. — Endlich hat M ü l l e r (1903
p. 10, 16) noch ein paar Beispiele von älteren Stadien mitgeteilt. Und ich halte für ganz
wahrscheinlich, daß noch manche andere Zellteilung des Ascariskeimes eine typisch inäquale
ist,, ohne bisher — infolge allzu geringer Größendifferenz der Produkte — als solche erkannt
zu sein.
K S t
Inäquale Teilung von a, nach
einem konservierten Präparate.