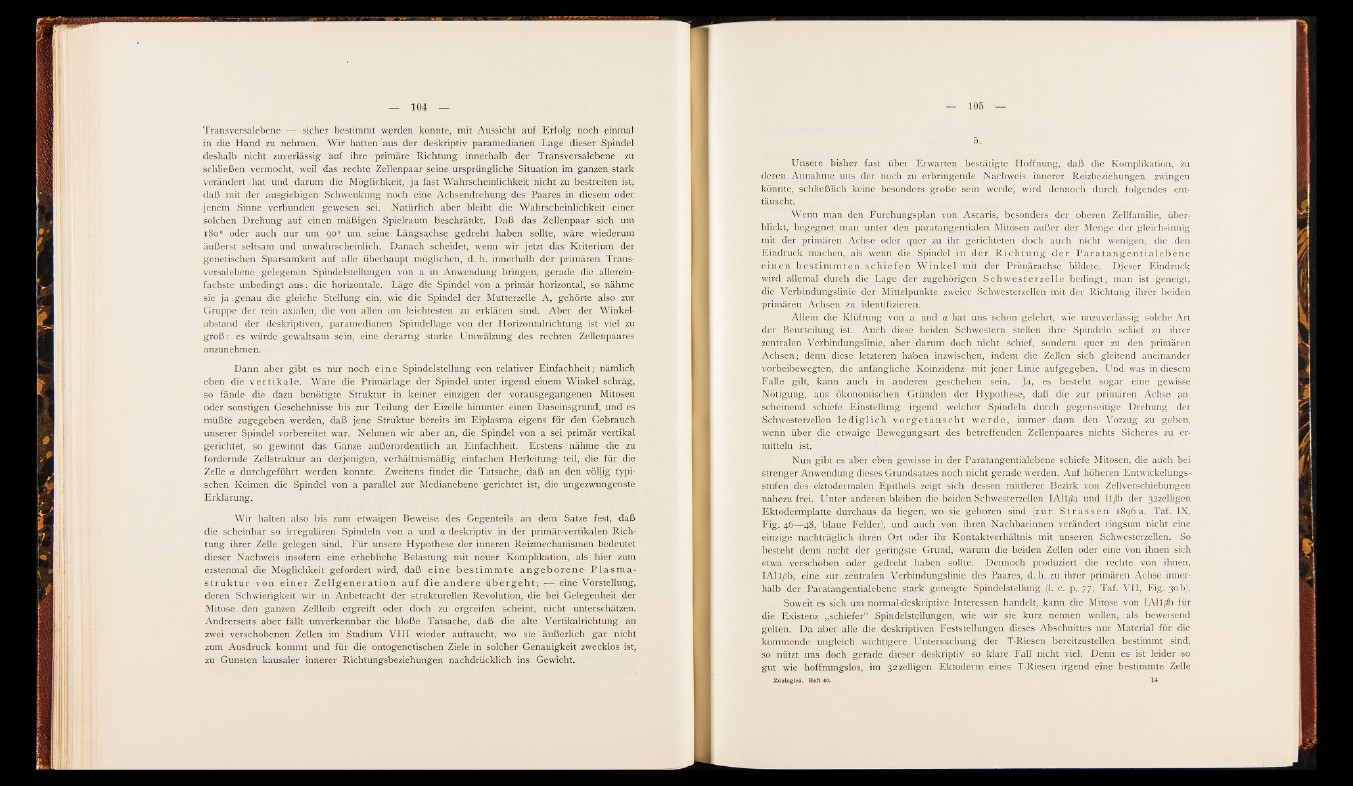
Transversalebene — sicher bestimmt werden konnte, mit Aussicht auf E r fo lg noch einmal
in die Hand zu nehmen. W ir hatten aus der deskriptiv paramedianen La g e dieser Spindel
deshalb nicht zuverlässig auf ihre primäre Richtung innerhalb der Transversalebene zu
schließen vermocht, weil das rechte Zellenpaar seine ursprüngliche Situation im ganzen stark
verändert .hat und darum die Möglichkeit, ja fast Wahrscheinlichkeit nicht zu bestreiten ist,
daß mit der ausgiebigen Schwenkung noch eine Achsendrehung des Paares in diesem oder
jenem Sinne verbunden gewesen sei. Natürlich aber bleibt die Wahrscheinlichkeit einer
solchen Drehung auf einen mäßigen Spielraum beschränkt. D aß das Zellenpaar sich um
i8o° oder auch nur um 900 um seine Längsachse gedreht haben sollte, wäre wiederum
äußerst seltsam und unwahrscheinlich. Danach scheidet, wenn wir jetzt das Kriterium der
genetischen Sparsamkeit auf alle überhaupt möglichen, d. h. innerhalb der primären Transversalebene
gelegenen Spindelstellungen von a in Anwendung bringen, gerade die allereinfachste
unbedingt a u s : die horizontale. L ä ge die Spindel von a primär horizontal, so nähme
sie ja genau die gleiche Stellung ein, wie die Spindel der Mutterzelle A , gehörte also zur
Gruppe der rein axialen, die von allen am leichtesten zu erklären sind. A ber der Winkelabstand
der deskriptiven, paramedianen Spindellage von der Horizontalrichtung ist viel zu
g r o ß : es würde gewaltsam sein, eine derartig starke Umwälzung des rechten Zellenpaares
anzunehmen.
Dann aber gib t es nur noch e in e Spindelstellung von relativer Einfachheit; nämlich
eben die v e r t i k a l e . Wä re die Primärlage der Spindel unter irgend einem Winkel schräg,
so fände die dazu benötigte Struktur in keiner einzigen der vorausgegangenen Mitosen
oder sonstigen Geschehnisse bis zur Teilung der Eizelle hinunter einen Daseinsgrund, und es
müßte zugegeben werden, daß jene Struktur bereits im Eiplasma eigens für den Gebrauch
unserer Spindel vorbereitet war. Nehmen wir aber an, die Spindel von a sei primär vertikal
gerichtet, so gewinnt das Ganze außerordentlich an Einfachheit. Erstens nähme die zu
fordernde Zellstruktur an derjenigen, verhältnismäßig einfachen Herleitung teil, die für die
Zelle a durchgeführt werden konnte. Zweitens findet die Tatsache, daß an den völlig typischen
Keimen die Spindel von a parallel zur Medianebene gerichtet ist, die ungezwungenste
Erklärung.
W ir halten also bis zum etwaigen Beweise des Gegenteils an dem Satze fest, daß
die scheinbar so irregulären Spindeln von a und a deskriptiv in der primär-vertikalen Richtung
ihrer Zelle gelegen sind. Für unsere Hypothese der inneren Reizmechanismen bedeutet
dieser Nachweis insofern eine erhebliche Belastung mit neuer Komplikation, als hier zum
erstenmal die Möglichkeit gefordert wird, d aß e in e b e s t im m t e a n g e b o r e n e P l a s m a s
t r u k t u r v o n e in e r Z e l l g e n e r a t i o n a u f d i e a n d e r e ü b e r g e h t ^ f^ e in e Vorstellung,
deren Schwierigkeit wir in Anbetracht der strukturellen Revolution, die bei Gelegenheit der
Mitose den ganzen Zellleib ergreift oder doch zu ergreifen scheint, nicht unterschätzen.
Andrerseits aber fällt unverkennbar die b loß e Tatsache, daß die alte Vertikalrichtung an
zwei verschobenen Zellen im Stadium V I I I wieder auf taucht, wo sie äußerlich gar nicht
zum Ausdruck kommt und für die ontogenetischen Ziele in solcher Genauigkeit zwecklos ist,
zu Gunsten kausaler innerer Richtungsbeziehungen nachdrücklich ins Gewicht.
5 .
Unsere bisher fast über Erwarten bestätigte Hoffnung, daß die Komplikation, zu
deren Annahme uns der noch zu erbringende Nachweis innerer Reizbeziehungen zwingen
könnte, schließlich keine besonders groß e sein werde, wird dennoch durch folgendes enttäuscht.
Wenn man den Furchungsplan von Ascaris, besonders der oberen Zellfamilie, überblickt,
begegnet man unter den paratangentialen Mitosen außer der Menge der gleichsinnig
mit der primären Achse* i oder quer zu ihr gerichteten doch auch nicht wenigen, die den
Eindruck machen, a ls ,wenn die Spindel in d e r R i c h t u n g d e r P a r a t a n g e n t i a l e b e n e
e in e n b e s t im m t e n s c h i e f e n W in k e l mit der Primärachse bildete. Dieser Eindruck
wird allemal durch die La g e der zugehörigen S c h w e s t e r z e l l e bedingt; man ist geneigt,
die Verbindungslinie der Mittelpunkte zweier Schwesterzellen mit der Richtung ihrer beiden
primären Achsen zu identifizieren.
Allein die Klüftung von a und a hat uns Schon gelehrt, wie unzuverlässig solche Art
der Beurteilung ist. Auch diese beiden Schwestern stellen ihre Spindeln schief zu ihrer
zentralen Verbindungslinie, aber darum doch nicht? Schief, sondern quer zu den primären
Achsen; denn diese letzteren haben inzwischen, indem die Zellen sich gleitend aneinander
vorbeibewegten, die anfängliche Koinzidenz mit jener Linie aufgegeben. Und was in diesem
Falle gilt, kann auch in anderen geschehen sein. Ja, es besteht sogar eine gewisse
Nötigung, aus ökonomischen Gründen der Hypothese, daß. die zur primären Achse anscheinend
schiefe Einstellung irgend welcher Spindeln durch gegenseitige Drehung der
Schwesterzellen l e d i g l i c h v o r g e t ä u s c h t w e r d e , immer dann den Vorzug zu geben,
wenn über die etwaige Bewegungsart des betreffenden Zellenpaares nichts Sicheres zu ermitteln
ist.
Nun gibt es aber eben gewisse in der Paratangentialebene schiefe Mitosen, die auch bei
strenger Anwendung dieses Grundsatzes noch nicht gerade werden. A u f höheren Entwickelungsstufen
des ektodermalen Epithels zeigt sich dessen mittlerer Bezirk von Zellverschiebungen
nahezu frei. Unter anderen bleiben die beiden Schwesterzellen IAll/Sa und llßb der 32zelligen
Ektodermplatte durchaus da liegen, wo sie geboren sind (z u r • S t r a s s e n 1896 a. T a f. IX,
Fig. 46— 48, blaue Felder), und auch von ihren Nachbarinnen verändert ringsum nicht eine
einzige nachträglich ihrèn Ort oder ihr Kontaktverhältnis mit unseren Schwesterzellen. So
besteht denn nicht der geringste Grund, warum die beiden Zellen oder eine von ihnen sich
etwa verschoben oder gedreht haben sollte. Dennoch produziert d iff rechte von ihnen,
IA llß b , eine zur zentralen Verbindungslinie des Paares, d. h. zu ihrer primären Achse innerhalb
der Paratangentialebene stark geneigte Spindelstellung (1. ,c. p. 77, Ta f. V I I , Fig. 30b).
Soweit es sich um normal-deskriptive Interessen handelt, kann die Mitose von IAll/3b für
die Existenz „schiefer“ Spindelstellungen, wie wir sie kurz nennen wollen* als beweisend
gelten. D a aber alle die deskriptiven Feststellungen dieses Abschnittes nur Material für die
kommende ungleich wichtigere Untersuchung der T-Riesen bereitzustellen bestimmt sind,
so nützt uns doch gerade dieser deskriptiv so klare Fall nicht viel. Denn es ist leider so
gut wie hoffnungslos, im 32zelligen Ektoderm eines T-Riesen irgend eine bestimmte Zelle
Zoologica. Heft 40. 14