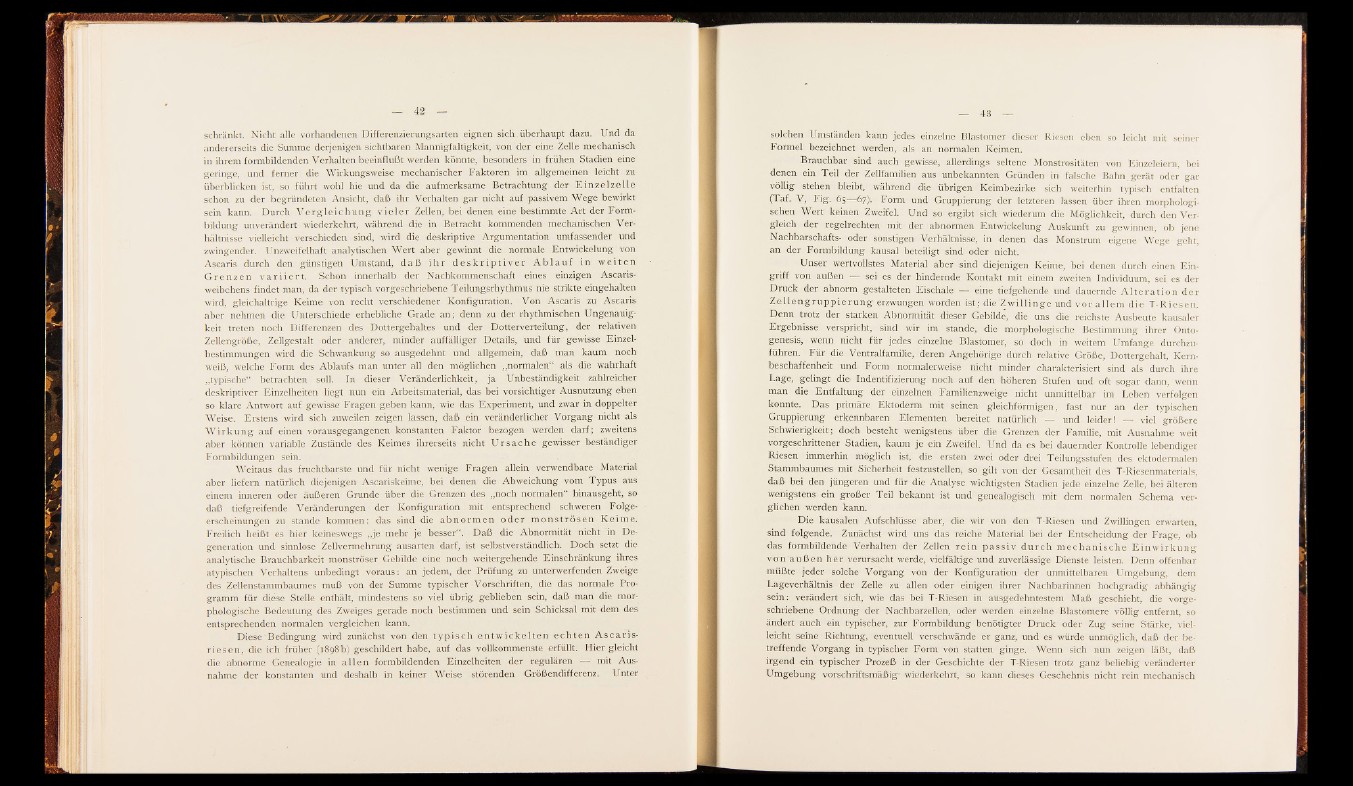
schränkt. Nicht alle vorhandenen Differenzierungsarten eignen s ich . überhaupt dazu. Und da
andererseits die Summe derjenigen sichtbaren Mannigfaltigkeit, von der eine Zelle mechanisch
in ihrem formbildenden Verhalten beeinflußt werden könnte, besonders in frühen Stadien eine
geringe, und ferner die Wirkungsweise mechanischer Faktoren im allgemeinen leicht zu
überblicken ist, so führt wohl hie und da die aufmerksame Betrachtung der E i n z e l z e l l e
schon zu der begründeten Ansicht, daß ihr Verhalten gar nicht auf passivem W e g e bewirkt
sein kann. Durch V e r g l e i c h u n g v i e l e r Zellen, bei denen eine bestimmte A r t der Formbildung
unverändert wiederkehrt, während die in Betracht kommenden mechanischen V e r hältnisse
vielleicht verschieden sind, wird die deskriptive Argumentation umfassender und
zwingender. Unzweifelhaft analytischen W e rt aber gewinnt die normale Entwickelung von
Ascaris durch den günstigen Umstand, d a ß ih r d e s k r i p t i v e r A b l a u f in w e i t e n
G r e n z e n v a r i i e r t . Schon innerhalb der Nachkommenschaft eines einzigen Ascarisweibchens
findet man, da der typisch vorgeschriebene Teilungsrhythmus nie strikte eingehalten
wird, gleichaltrige Keime von recht verschiedener Konfiguration. Von Ascaris zu Ascaris
aber nehmen die Unterschiede erhebliche Grade an; denn zu der rhythmischen Ungenauigkeit
treten noch Differenzen des Dottergehaltes und der Dotterverteilung, der relativen
Zellengröße, Zellgestalt oder anderer, minder auffälliger Details, und für gewisse Einzelbestimmungen
wird die Schwankung so ausgedehnt und allgemein, daß man kaum noch
weiß, welche Form des Ablaufs man unter all den möglichen „normalen“ als die wahrhaft
„typische“ betrachten soll. In dieser Veränderlichkeit, ja Unbeständigkeit zahlreicher
deskriptiver Einzelheiten liegt nun ein Arbeitsmaterial, das bei vorsichtiger Ausnutzung eben
so klare Antwort auf gewisse Fragen geben kann, wie das Experiment, und zwar in doppelter
Weise. Erstens wird sich zuweilen zeigen lassen, daß ein veränderlicher Vo rg an g nicht als
W i r k u n g auf einen vorausgegängenen konstanten Faktor bezogen werden darf; zweitens
aber können variable Zustände des Keimes ihrerseits nicht U r s a c h e gewisser beständiger
Formbildungen sein.
Weitaus das fruchtbarste und für nicht wenige Fragen allein verwendbare Material
aber liefern natürlich diejenigen Ascariskeime, bei denen die Abweichung vom Typus aus
einem inneren oder äußeren Grunde über die Grenzen des „noch normalen“ hinausgeht, so
daß tiefgreifende Veränderungen der Konfiguration mit entsprechend schweren Fo lg e erscheinungen
zu Stande kommen: das sind die a b n o rm e n o d e r m o n s t r ö s e n K e im e .
Freilich heißt es hier keineswegs „ je mehr je besser“ . D a ß die Abnormität nicht in Degeneration
und sinnlose Zellvermehrung ausarten darf, ist selbstverständlich. Doch setzt die
analytische Brauchbarkeit monströser Gebilde eine noch weitergehende Einschränkung ihres
atypischen Verhaltens unbedingt voraus: an jedem, der Prüfung zu unterwerfenden Zweige
des Zellenstammbaumes muß von der Summe typischer Vorschriften, die das normale Programm
für diese Stelle enthält, mindestens so viel übrig geblieben sein, daß man die morphologische
Bedeutung des Zweiges gerade noch bestimmen und sein Schicksal mit dem des
entsprechenden normalen vergleichen kann.
D ie s e ' Bedingung wird zunächst von den t y p i s c h e n tw i c k e l t e n e c h t e n A s c a r i s r
i e s e n , die ich früher (1898 b) geschildert habe, auf das vollkommenste erfüllt. Hier gleicht
die abnorme Genealogie in a l l e n formbildenden Einzelheiten der regulären — mit A u s nahme
der konstanten und deshalb in keiner Weise störenden Größendifferenz. Unter
solchen Umständen kann jedes einzelne Blastomer dieser Riesen eben so leicht mit seiner
Formel bezeichnet werden, als an normalen Keimen.
Brauchbar sind auch gewisse, allerdings seltene Monstrositäten von Einzeleiern, bei
denen ein T e il der Zellfamilien aus unbekannten Gründen in falsche Bahn gerät oder gar
völlig stehen bleibt, während die übrigen Keimbezirke sich weiterhin typisch entfalten
(Taf. V, F ig. 65— 67). Form und Gruppierung der letzteren lassen über ihren morphologischen
Wert keinen Zweifel. Und so^ ergibt sich wiederum die Möglichkeit, durch den Ve r gleich
der regelrechten mit der abnormen Entwickelung Auskunft zu gewinnen, ob jene
Nachbarschafts- oder sonstigen Verhältnisse, in denen das Monstrum eigene Weg e geht,
an der Formbildung kausal beteiligt sind oder nicht.
Unser wertvollstes Material aber sind diejenigen Keime, bei denen durch einen Eing
r iff von außen sei es der hindernde Kontakt mit einem zweiten Individuum, sei es der
Druck der abnorm gestalteten Eischale #4 eine tiefgehende und dauernde A l t e r a t i o n d e r
Z e l l e n g r u p p i e r u n g erzwungen worden ist; die Z w i l l i n g e und v o r a l lem d ie T -R ie s e n .
Denn trotz der starken Abnormität dieser Gebilde, die uns die reichste Ausbeute kausaler
Ergebnisse verspricht, sind wir im Stande, die morphologische Bestimmung ihrer Onto-
genesis, wenn nicht für jedes einzelne Blastomer, so doch in weitem Umfange durchzu-
iuhren. Für die, Ventralfamilie, deren Angehörige durch relative Größe, Dottergehalt, Kern-
beschaffenheit und :Form normalerweise nicht minder charakterisiert sind als durch ihre
Lage, gelingt die Indentifizierung noch auf den höheren Stufen und oft sogar dann, wenn
man die Entfaltung der einzelnen Familienzweige nicht unmittelbar im Leben verfolgen
konnte. Das primäre Ektoderm mit seinen gleichförmigen, fast nur an der typischen
Gruppierung erkennbaren Elementen bereitet natürlich — und leider! — viel größere
Schwierigkeit; doch besteht wenigstens über die Grenzen der Familie, mit Ausnahme weit
vorgeschrittener Stadien, kaum je ein Zweifel. Und da es bei dauernder Kontrolle lebendiger
Riesen immerhin möglich ist, die ersten zwei öder drei Teilungsstufen des ektodermalen
Stammbaumes mit Sicherheit festzustellen, so gilt von der Gesamtheit des T-Riesenmaterials,
daß bei den jüngeren und für die Analyse wichtigsten Stadien jede einzelne Zelle, bei älteren
wenigstens ein großer T e il bekannt ist und genealogisch mit dem normalen Schema verglichen
werden kann.
Die kausalen Aufschlüsse aber, die wir von den T-Riesen und Zwillingen erwarten,
sind folgende. Zunächst wird uns das reiche Material bei der Entscheidung der Frage, ob
das formbildende Verhalten der Zellen r e in p a s s i v d u r c h m e c h a n i s c h e E i n w i r k u n g
v o n a u ß e n h e r verursacht werde, vielfältige und zuverlässige Dienste leisten. Denn offenbar
müßte jeder solche V o rgang von der Konfiguration der unmittelbaren Umgebung, dem
Lageverhältnis der Zelle zu allen oder einigen ihrer Nachbarinnen hochgradig abhängig
sein: verändert sich, wie das bei T-Riesen in ausgedehntestem Maß geschieht, die vorgeschriebene
Ordnung der Nachbarzellen, oder werden einzelne Blastomere völlig entfernt, so
ändert auch ein typischer, zur Formbildung benötigter Druck oder Zug seine Stärke, vielleicht
seine Richtung, eventuell verschwände er ganz, und es würde unmöglich, daß der betreffende
Vo rgang in typischer Form von statten ginge. Wenn sich nun zeigen läßt, daß
irgend ein typischer Prozeß in der Geschichte der T-Riesen trotz ganz beliebig veränderter
Umgebung vorschriftsmäßig* wiederkehrt, so kann dieses Geschehnis nicht rein mechanisch