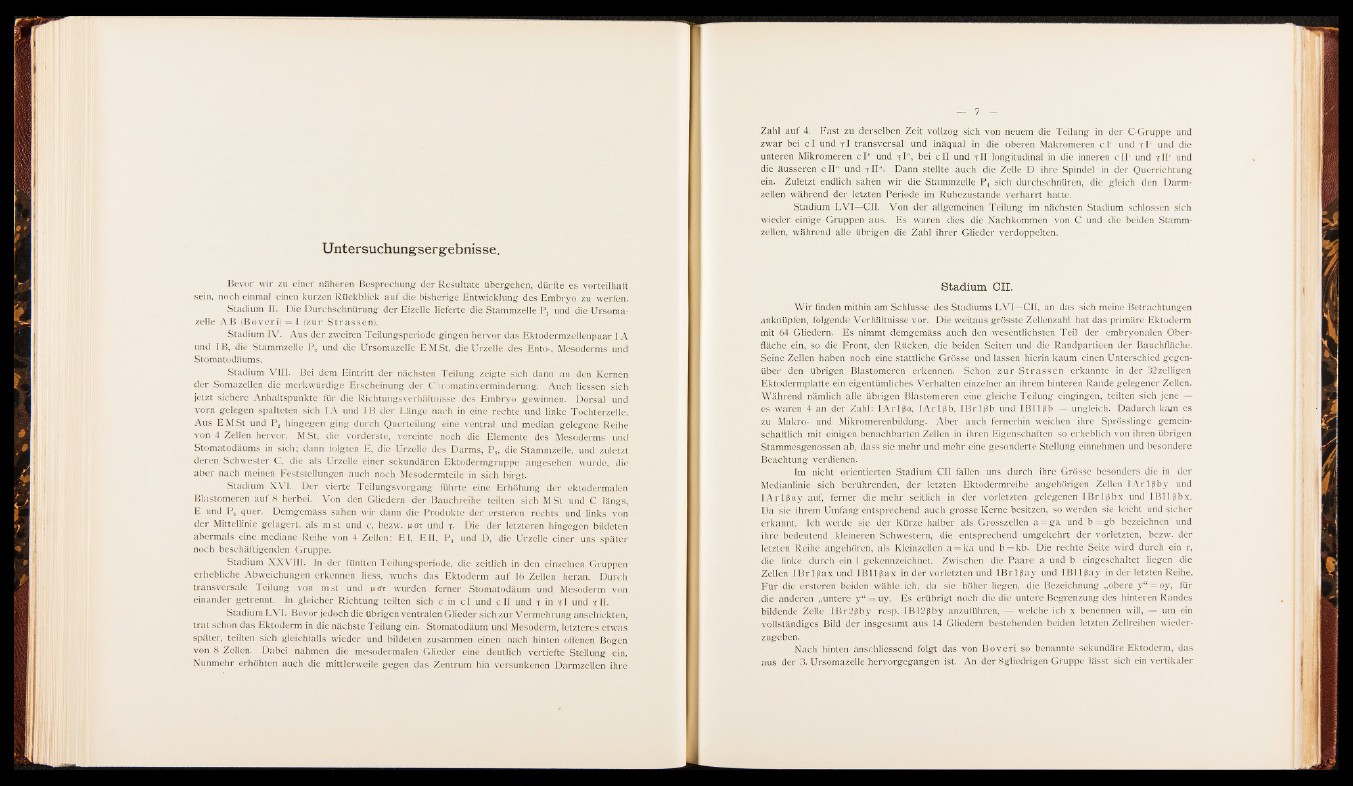
Untersuchungsergebnisse.
Bevor wir zu einer näheren Besprechung der Resultate übergehen, dürfte es vorteilhaft
sein, noch einmal einen kurzen Rückblick au f die bisherige Entwicklung des Embryo zu werfen.
Stadium II. Die Durchschnürung der Eizelle lieferte die Stammzelle P, und die Ursoma-
zelle A B (B o v e r i) = I (zu r S t r a s s e n ) .
Stadium IV . Aus der zweiten Teilungsperiode gingen hervor das Ektodermzellenpaar I A
und IB , die Stammzelle P 2 und die Ursomazelle E M St, die Urzelle des Ento-, Mesoderms und
Stomatodäums.
Stadium VIII. Bei dem Eintritt der nächsten Teilung zeigte sich dann au den Kernen
der Somazellen die merkwürdige Erscheinung der Chromatinverminderung. Auch Hessen sich
jetz t sichere Anhaltspunkte für die Richtungsverhältnisse des Embryo gewinnen. Dorsal und
vorn gelegen spalteten sich I A und IB der Länge nach in eine rechte und linke Tochterzelle..
A u s EM S t und Ps hingegen ging durch Querteilung eine ventral und median gelegene Reihe
von 4 Zellen hervor. MSt, die vorderste, vereinte noch die Elemente des Mesoderms und
Stomatodäums in sich; dann folgten E, die Urzelle des Darms, P 9, die Stammzelle, und zuletzt
deren Schwester C, die als Urzelle einer sekundären Ektodermgruppe angesehen wurde, die
aber nach meinen Feststellungen auch noch Mesodermteile in sich birgt.
Stadium X V I . Der vierte Teilungsvorgang führte eine Erhöhung der ektodermalen
Blastomeren au f 8 herbei. Von den Gliedern der Bauchreihe teilten sich M S t und C längs,
E und P8 quer. Demgemäss sahen wir dann die Produkte der ersteren rechts und links von
der Mittellinie gelagert, als m s t und c, bezw. iktt und t- Die der letzteren hingegen bildeten
abermals eine mediane Reihe von 4 Zellen: E I , EU , P4 und D, die Urzelle einer uns später
noch beschäftigenden Gruppe.
Stadium XXVIII. ln der fünften Teilungsperiode, die zeitlich in den einzelnen Gruppen
erhebliche Abweichungen erkennen liess, wuchs das Ektoderm au f 16 Zellen heran. Durch
transversale Teilung von m s t und h<tt wurden ferner Stomatodäum und Mesoderm von
einander getrennt. In gleicher Richtung teilten sich c in c l und e i l und y in y I und yII.
Stadium L V I . Bevor jedoch die übrigen ventralen G lieder sich zur Vermehrung anschickten,,
trat schon das Ektoderm in die nächste Teilung ein. Stomatodäum und Mesoderm, letzteres etwas
später, teilten sich gleichfalls wieder und bildeten zusammen einen nach hinten offenen Bogen
von 8 Zellen. Dabei nahmen die mesodermalen Glieder eine deutlich vertiefte Stellung ein.
Nunmehr erhöhten auch die mittlerweile gegen das Zentrum hin versunkenen Darmzellen ihre
Zahl au f 4. F as t zu derselben Zeit vollzog sich von neuem die Teilung in der C-Gruppe und
zw a r bei c l und y I transversal und inäqual in die oberen Makromeren cP und rP und die
unteren Mikromeren c l " und y I" , bei e i l und y II longitudinal in die inneren e i l ' und yII' und
die äusseren e i l " und yII"- Dann stellte auch die Zelle D ihre Spindel in der Querrichtung
ein. Zuletzt endlich sahen wir die Stammzelle P 4 sich durchschnüren, die gleich den Darmzellen
während der letzten Periode im Ruhezustände verharrt hatte.
Stadium L V I— CII. V on der allgemeinen Teilung im nächsten Stadium schlossen sich
wieder einige Gruppen aus. Es waren dies die Nachkommen von C und die beiden Stammzellen,
während alle übrigen die Zahl ihrer Glieder verdoppelten.
Stadium OII.
W ir finden mithin am Schlüsse des Stadiums L V I— CII, an das sich meine Betrachtungen
anknüpfen, folgende Verhältnisse vor. Die weitaus grösste Zeilenzahl hat das primäre Ektoderm
mit 64 Gliedern. Es nimmt demgemäss auch den wesentlichsten Teil der embryonalen Oberfläche
ein, so die Front, den Rücken, die beiden Seiten und die Randpartieen der Bauchfläche.
Seine Zellen haben noch eine stattliche Grösse und lassen hierin kaum einen Unterschied gegenüber
den übrigen Blastomeren erkennen. Schon z u r S t r a s s e n erkannte in der 32zelligen
Ektodermplatte ein eigentümliches Verhalten einzelner an ihrem hinteren Rande gelegener Zellen.
Während nämlich alle übrigen Blastomeren eine gleiche Teilung eingingen, teilten sich jene —
e s waren 4 an der Zahl: IA r lß a , IA r lß b , IB r lß b und I B l lß b — ungleich. Dadurch kam es
zu Makro- und Mikromerenbildung. A b e r auch fernerhin weichen ihre Sprösslinge gemeinschaftlich
mit einigen benachbarten Zellen in ihren Eigenschaften so erheblich von ihren übrigen
Stammesgenossen ab, dass sie mehr und mehr eine gesonderte Stellung einnehmen und besondere
Beachtung verdienen.
Im nicht orientierten Stadium CII fallen uns durch ihre Grösse besonders die in der
Medianlinie sich berührenden, der letzten Ektodermreihe angehörigen Zellen I A r l ß b y und
I A r l ß a y auf, ferner die mehr seitlich in der vorletzten gelegenen I B r l ß b x und IB l lß b x .
D a sie ihrem Umfang entsprechend auch grosse Kerne besitzen, so werden sie leicht und sicher
erkannt. Ich werde sie der Kürze halber als Grosszellen a = g a und b = g b bezeichnen und
ihre bedeutend kleineren Schwestern, die entsprechend umgekehrt der vorletzten, bezw. der
letzten Reihe angehören, als Kleinzellen a = k a und $> fSkb. Die rechte Seite wird durch ein r,
die linke durch ein 1 gekennzeichnet. Zwischen die Paare a und b eingeschaltet liegen die
Zellen I B r l ß a x und I B l lß a x in der vorletzten und I B r l ß a y und I B l lß a y in der letzten Reihe.
F ü r die ersteren beiden wähle ich, da sie höher liegen, die Bezeichnung „obere y “ ||ioy, für
die anderen „untere y “ = uy. Es erübrigt noch die die untere Begrenzung des hinteren Randes
bildende Zelle I B r 2ß b y resp. I B 12ß b y anzuführen, — welche ich x benennen will, H u m ein
vollständiges Bild der insgesamt aus 14 Gliedern bestehenden beiden letzten Zellreihen wiederzugeben.
Nach hinten anschliessend folgt das von B o v e r i so benannte sekundäre Ektoderm, das
aus der 3. Ursomazelle hervorgegangen ist. An der Sgliedrigen Gruppe lässt sich ein vertikaler