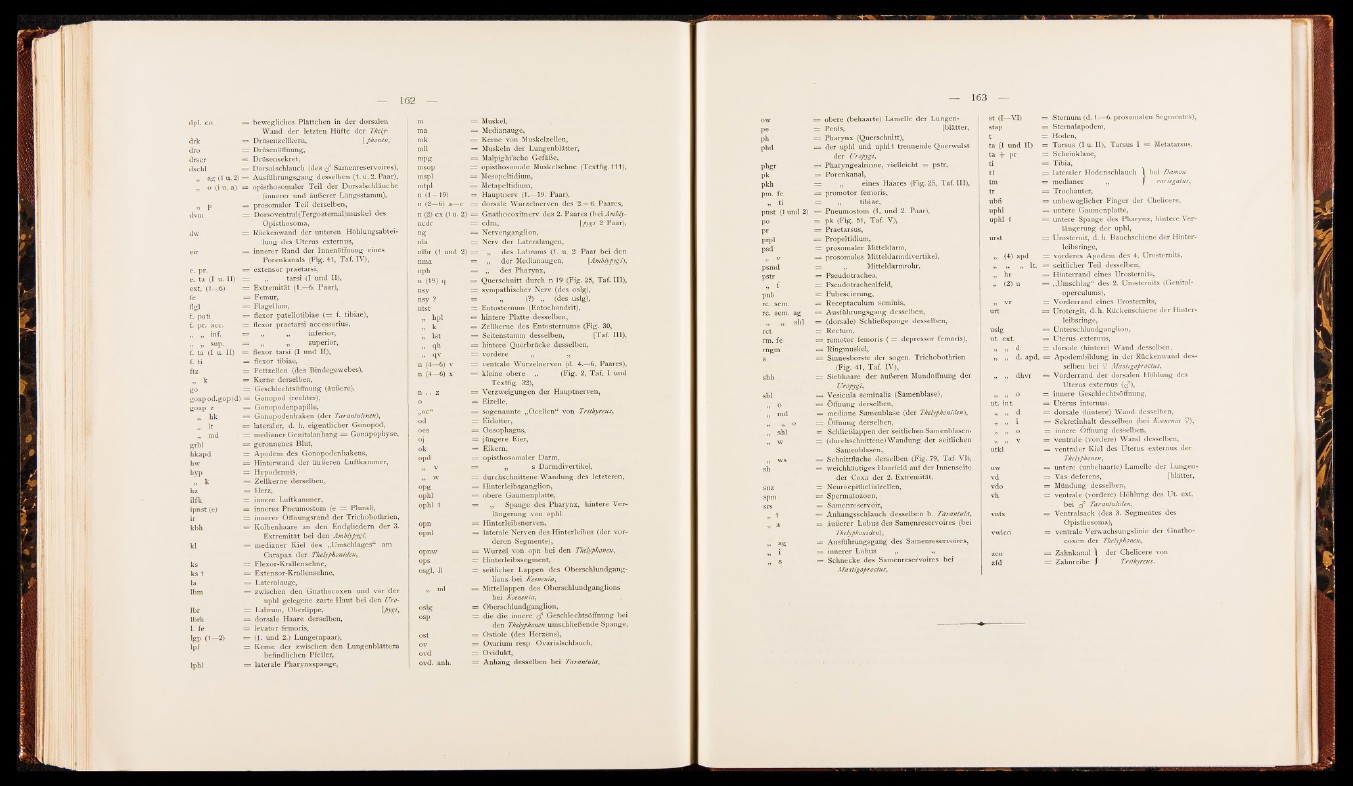
dpi. co
drk
dro
drscr
dschl
,, ag (1 u. 2) ;
„ o (i u. a) :
» P
dvm
dw
eir
e. pr.
e. ta (I u. ir j <
ext. (1—6)
fe
flgl
f. pati
f. pr. ace.
„ „ inf.
„ „ sup.
f. ta (I u. II)
f. ti
ftz
! k
go
goap od.gop(d)
goap z
„ hk
» 1t
»
grbl
likapd
hw
hyp
„ k
hz
ilfk
ipnst (e)
kbh
kl
ks
ks 1
la
lbm
lbr
lbrh
1. fe
Igp (1- 2) .
lpf
lphl
bewegliches Plättchen in der dorsalen
Wand der letzten Hüfte der Thely-
Drüsenzellkern, [phonin,
Drüsenöffnung,
Drüsensekret,
Dorsalschlauch (des c f Samenreservoires),
Ausführungsgang desselben (1. u. 2. Paar),
opisthosomaler Teil der Dorsalschläuche
(innerer und äußerer Längsstamm),,
prosomaler Teil derselben,
Dorsoventral(Tergosternal)muskel des
Opisthosoma,
Rückenwand der unteren Höhlungsabteilung
des Uterus extemus,
innerer Rand der Innenöffnung eines
Porenkanals (Fig. 41, Taf. IV)>
extensor praetarsi,
„ tarsi (I und II),
Extremität (1.—6. Paar),
Femur,
Flageilum,
flexor patellotibiae (= f. tibiae),
flexor praetarsi accessorius,
„ inferior,
„ „ superior,
flexor tarsi (I und II),
flexor tibiae,
Fettzellen (des Bindegewebes),
Kerne derselben,
Geschlechtsöffnung (äußere).
Gonopod (rechter),
Gonopodenpapille,
Gonopodenhaken (der Tarantulinen),
lateraler, d. h. eigentlicher Gonopod,
medianer Genitalanhang = Gonapophyse,
geronnenes Blut,
Apodem des Gonopodenhakens,
Hinterwand der äußeren Luftkammer,
Hypodermis,
Zellkerne derselben,
Herz,
innere Luftkammer,
inneres Pneumostom (e = Plural),
innerer Öffnungsrand der Trichobothrien,
Kolbenhaare an den Endgliedern der 3.
Extremität bei den Amblypygi,
medianer Kiel des „Umschlages“ am
Carapax der Thelyphoniden,
Flexor-Krallensehne,
Extensor-Krallensehne,
•' Lateralauge,
= zwischen den Gnathocoxen und vor der
uphl gelegene zarte Haut bei den Uro-
Labrum, Oberlippe, [py&->
dorsale Haare derselben,
levator femoris,
(1. und 2.) Lunge(npaar),
Kerne der zwischen den Lungenblättern
befindlichen Pfeiler,
laterale Pharynxspange,
m = Muskel,
ma = Medianauge,
mk = Kerne Von Muskelzellen,
mll = Muskeln der Lungenblätter,
mpg = Malpighi’sche Gefäße,
msop = opisthosomale Muskelsehne (Textfig. 111),
mspl = Mesopeltidium,
mtpl = Metapeltidium,
n (1 -19 ) = Hauptnerv Paar),j~ \
n (2—6) a—e dorsale Wurzelnerven des 2.— 6. Paares,
n (2) cx flu. 2) f=9 Gnathocoxitnerv des 2. Paares (bei Amblyncdr
: = Cdrn, [pygi 2 Paar),
ng = Nervenganglion,
nla = Nerv der Lateralaugen,
nlbr (1 und 2) == „ des Labrums (1. u. 2 Paar bei den
nma = „ der Medianaugen, [Amblypygi),
nph „ des Pharynx,
n (19) q = Querschnitt durch n 19 (Fig. 25, Taf. III),
nsy = sympathischer Nerv (des oslg),
nsy ? = „ - . (?) „ (des uslg),
ntst = Entosternum (Entöchondrit),
„ hpl = hintere Platte desselben,
„ k Zellkerne des Entosternums (Fig. 30,.
„ Ist = Seitenstamm desselben, [Taf. III),
„ qh , = hintere. Querbrücke desselben,
„ qv ~''‘31=i vordere „ ’
n (4—6) v = ventrale Wurzelnerven (d. 4.— 6. Paares),
n (4—6) x = klèine obere „ ' (Fig. 2, Taf. I und
Textfig. 32),
n . . z = Verzweigungen der Hauptnerven,,
o = Eizelle,
„oc“ = sogenannte „Ocellen“ von Trithyreus,
od = Eidotter,
oes = Oesophagus,
oj - = jüngere Eier,
ok = Eikern,
opd == opisthosomaler Darm,
„ v . j, s Darmdivertikel,
„ w 'S ik durchschnittene Wandung des letzteren,
opg Hinterleibsganglion,
ophl = obere Gaumenplatte,
ophl 1 = „ Spange des Pharynx, hintere Verlängerung
von ophl.
opn Hinterleibsnerven,
opnl = laterale Nerven des Hinterleibes (der vorderen
Segmente),
opnw = Wurzel von opn bei den Thelyphonen,
ops y Hinterleibssegment,
osgl. 11 = seitlicher Lappen des Oberschlundganglions
bei Koenenia,
» ml ' S Ì MittellaPPen des Oberschlundganglions
bei Koenema,
oslg — Oberschlundganglion,
osp = die. die innere <f Geschlechtsöffnung bei
den Thelyphonen umschließende Spange,
ost = Ostiole (des Herzèns),
ov • %=; Ovariüm rèsp. Ovarialschlauch,
ovd = Ovidukt,
ovd. anh. = Anhang desselben bei' Tarantola,
ow ¿p=lobere (behaarte) Lamelle der Lungenpe
.;;^ ^SPen is, [blätter,
ph = Pharynx (Querschnitt^^!
phd = der uphl und uphl l trennende Querwulst
der Uropygi,
phgr == Pharyngealrinne, vielleicht = pstr,
pk == Porenkanal,
pkh = „ eines Haares (Fig. 25, Taf. III),
pm. fe = promotor femo.ris,
„ ti = „ tibiae,
pnst (1 und 2) = Pneumostom (1. und 2. Paar),
po = pk (Fig. 51, Taf. V),
pr = Praetarsus,
prpl = Propeltidium,
psd prosomaler Mitteldarm,
v = prosomales Mitteldarmdivertikel,
psmd . == . „ - Mitteldarmrohr,
pstr = Pseudotrachea,
)5 f ' = Pseudotrachealfeld,
pub = Pubescierung,
rc. sem. = Receptaculum seminis,
rc. sem. ag Ausführungsgang desselben,
:; „ „ shl = (dorsale) Schließspange desselben,
rct = Rectum,
rm. fe . . = remotor femoris ( = depressor femoris),
rngm = Ringmuskel,
s - = Sinnesborste der sogen. Trichobothrien
(Fig. 41, Täf. IV),-
sbh = Siebhaare der äußeren Mundöffnung der
Uropygi,
sbl '== Vesicula seminalis (Sämenblase),
» ° — Öffnung derselben,
' md = mediane Samenblase (der Thelyphoniden)^.
;o . == Öffnung derselben,
shl = Schließlappen der seitlichen Samenblasen?
w = (durchschnittene) Wandung der seitlichen
Samenblasen,
„ ws = Schnittfläche derselben (Fig. 79, Taf. VI),
sh weichhäutiges Haarfeld auf der Innenseite
der Coxa der 2. Extremität,
snz = Neuroepithelialzellen,
spm == Spermatozoen,
srs Samenreservoir,
1 = Anhangsschlauch desselben b. Taräntola,
a = äußerer Lobus des Samenreservoires (bei
. Thelyphoniden),
' ¿g = Ausführungsgang des Samenreservoires,
i CvS3s=? innerer Lobus ,, „
s = Schnecke des Samenreservoires bei
Mastigoproctus,
st (I—VI) = Sternum (d. 1.— 6. prosomalen Segmentes),
stap . fp.Steraalapodem,
t = Hoden,
ta (I und II) == Tarsus (I u. II), Tarsus I = Metatarsus,
ta + pr = Scheinklaue,
ti = Tibia,
tl » l a t e r a l e r Hodenschlauch \ bei Dämon
tm = medianer „ J variegatos,
tr = Trochanter,
ubfi = unbeweglicher Finger der Chelicere,
uphl = untere Gaumenplatte,
uphl 1 ¡Ä u n te re Spange des Pharynx, hintere Verlängerung
der uphl,
urst == Urosternit, d. h. Bauchschiene der Hinterleibsringe,
„ (4) apd = vorderes Apodem des 4. Urosternits,
. „ „ „ lt. = seitlicher Teil desselben,
„ hr = Hinterrand eines Urosternits,
„ (2) u ' = „Umschlag“ des 2. Urosternits (Genitaloperculums),
vr )==:. Vorderrand eines Urosternits,
urt == Urotergit, d. h. Rückenschiene der Hinterleibsringe,
uslg == Unterschlundganglion,
ut. ext. . = Uterus externus,
„ „ d. = dorsale (hintere) Wand desselben,
„ „ d. apd. = Apodembildung in der Rückenwand desselben
bei O Mastigoproctus,
„ ,, dhvr = Vorderrand der dorsalen Höhlung des
Uterus extemus (cf), .
gfipfll o = innere Geschlechtsöffnung,
ut. int. = Uterus internus;
„ „ d = dorsale (hintere) Wand desselben,
„ „ • i = Sekretinhalt desselben (bei Koenenia 9),
„ o = innere Öffnung desselben,
„ „ v = ventrale (vordere) Wand desselben,
utkl = ventraler Kiel des Uterus externus der
Thelyphonen,
uw = untere (unbehaarte) Lamelle der Lungenvd
= Vas deferens, [blätter,
vdo = Mündung desselben,
vh = ventrale (vordere) Höhlung des Ut. ext.
bei ( f Tarantuliden,
vnts = Ventralsack (des 3. Segmentes des
Opisthosoma),
vwlco = ventrale Verwachsungslinie der Gnathocoxen
der Thelyphonen,
zcn = Zahnkanal 1 der Chelicere von
zfd = Zahnreihe / Trithyreus. .