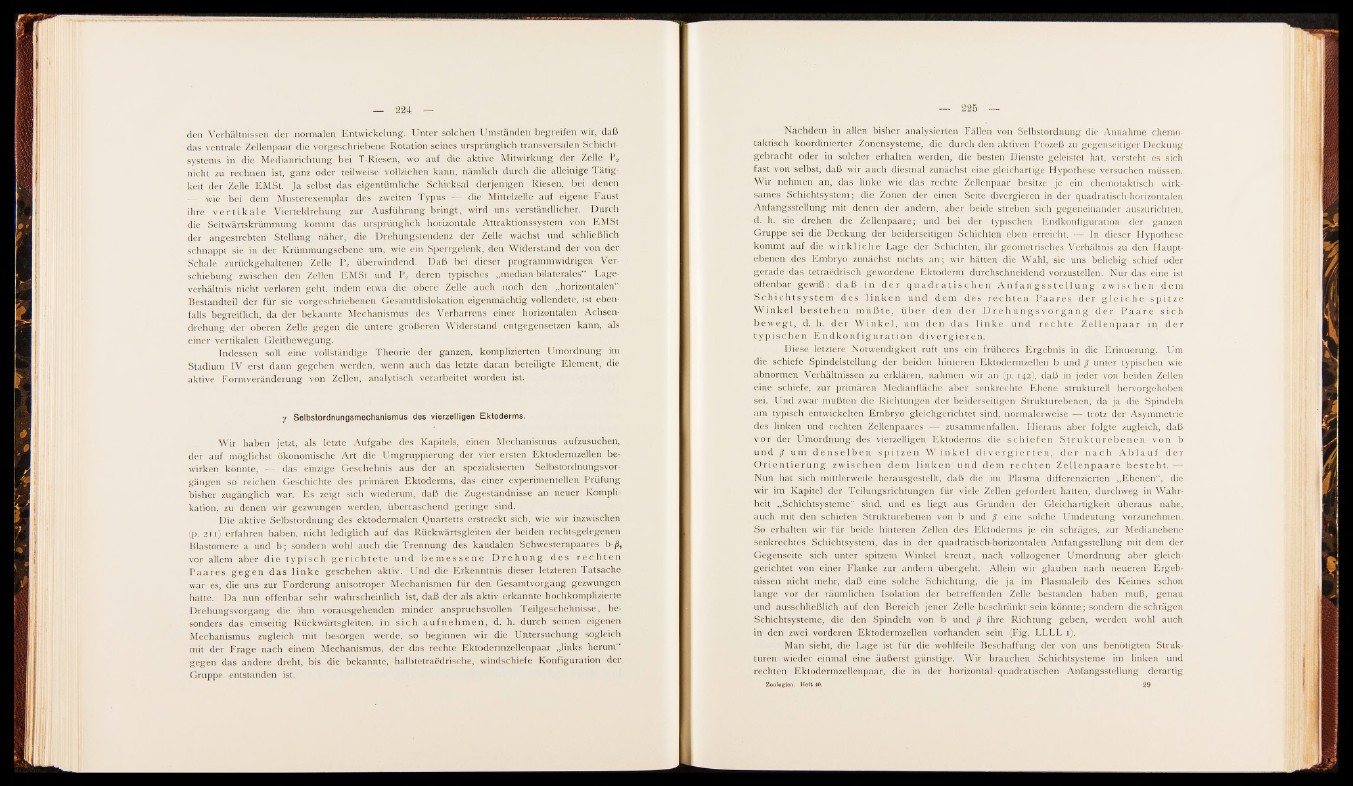
den Verhältnissen der normalen Entwickelung. Unter solchen Umständen begreifen wir, daß
das ventrale Zellenpaar die vorgeschriebene Rotation seines ursprünglich transversalen Schichtsystems
in die Medianrichtung bei T-Riesen, wo auf die aktive Mitwirkung der Zelle P 2
nicht zu rechnen ist, ganz oder teilweise vollziehen kann, nämlich durch die alleinige T ä tig keit
der Zelle EMSt. Ja selbst das eigentümliche Schicksal derjenigen Riesen, bei denen
— wie bei dem Musterexemplar des zweiten Typus — die Mittelzelle auf eigene Faust
ihre v e r t i k a l e Vierteldrehung zur Ausführung bring t, wird uns verständlicher. Durch
die Seitwärtskrümmung kommt das ursprünglich horizontale Attraktionssystem von EM St
der angestrebten Stellung näher, die Drehungstendenz der Zelle wächst und schließlich
schnappt sie in der Krümmungsebene um, wie ein Sperrgelenk, den Widerstand der von der
Schale zurückgehaltenen Zelle P2 überwindend. D aß bei dieser programmwidrigen V e r schiebung
zwischen den Zellen EM St und P2 deren typisches „median-bilaterales L a g e verhältnis
nicht verloren geht, indem etwa die obere Zelle auch noch den „horizontalen
Bestandteil der für sie vorgeschriebenen Gesamtdislokation eigenmächtig vollendete, ist ebenfalls
begreiflich, da der bekannte Mechanismus des Verharrens einer horizontalen Achsendrehung
der oberen Zelle gegen die untere größeren Widerstand entgegensetzen kann, als
einer vertikalen Gleitbewegung.
Indessen soll eine vollständige Theorie der ganzen, komplizierten Umordnung im
Stadium IV erst dann gegeben werden, wenn auch das letzte daran beteiligte Element, die
aktive Formveränderung von Zellen, analytisch verarbeitet worden ist.
y Selbstordnungsmechanismus des vierzelligen Ektoderms.
W ir haben jetzt, als letzte Aufgabe des Kapitels, einen Mechanismus aufzusuchen,
der auf möglichst ökonomische Art die Umgruppierung der vier ersten Ektodermzellen bewirken
könnte, — das einzige Geschehnis aus der an spezialisierten Selbstordnungsvorgängen
so reichen Geschichte des primären Ektoderms, das einer experimentellen Prüfung
bisher zugänglich war. E s zeigt sich wiederum, daß die Zugeständnisse an neuer Komplikation,
zu denen wir gezwungen werden, überraschend geringe sind.
Die aktive Selbstordnung des ektodermalen Quartetts erstreckt sich, wie wir inzwischen
(p. 2 1 1) erfahren haben, nicht lediglich auf das Rückwärtsgleiten der beiden rechtsgelegenen
Blastomere a und b ; sondern wohl auch die Trennung des kaudalen Schwesternpaares b-0,
vor allem aber d i e t y p i s c h g e r i c h t e t e u n d b e m e s s e n e D r e h u n g d e s r e c h t e n
P a a r e s g e g e n d a s l in k e geschehen aktiv. Und die Erkenntnis dieser letzteren Tatsache
war es, die uns zur Forderung anisotroper Mechanismen für den Gesamtvorgang gezwungen
hatte. Da nun offenbar sehr wahrscheinlich ist, daß der als aktiv erkannte hochkomplizierte
Drehungsvorgang die ihm vorausgehenden minder anspruchsvollen Teilgeschehnisse, besonders
das einseitig Rückwärtsgleiten, in s i c h a u f n e h m e n , d. h. durch seinen eigenen
Mechanismus zugleich mit besorgen werde, so beginnen wir die Untersuchung sogleich
mit der F ra ge nach einem Mechanismus, der das rechte Ektodermzellenpaar „links herum“
gegen das andere dreht, bis die bekannte, halbtetraedrische, windschiefe Konfiguration der
Gruppe entstanden ist.
Nachdem in allen bisher analysierten Fällen von Selbstordnung die Annahme chemotaktisch
koordinierter Zonensysteme, die durch den aktiven Prozeß zu gegenseitiger Deckung
gebracht oder in solcher erhalten werden, die besten Dienste geleistet hat, versteht es sich
fast von selbst, daß wir auch diesmal zunächst eine gleichartige Hypothese versuchen müssen.
Wir nehmen an, das linke wie das rechte Zellenpaar besitze je ein chemotaktisch wirksames
Schichtsystem; die Zonen der einen Seite divergieren in der quadratisch-horizontalen
Anfangsstellung mit denen der ändern, aber beide streben sich gegeneinander auszurichten,
d. h. sie drehen die Zellenpaare; und bei der typischen Endkonfiguration der ganzen
Gruppe sei die Deckung der beiderseitigen Schichten eben erreicht. — In dieser Hypothese
kommt auf die w i r k l i c h e - La g e der Schichten, ihr geometrisches Verhältnis zu den Haupt-
ebenen des Embryo zunächst nichts a n ; wir hätten die Wahl, sie uns beliebig schief oder
gerade das tetraedrisch gewordene Ektoderm durchschneidend vorzustellen. Nur das eine ist
offenbar g ew iß : d a ß in d e r q u a d r a t i s c h e n A n f a n g s s t e l l u n g z w i s c h e n d em
S c h i c h t s y s t e m d e s l in k e n u n d d em d e s f e c h t e n P a a r e s d e r g l e i c h e s p i t z e
W in k e l b e s t e h e n m ü ß t e , ü b e r d e n d e r D r e h u n g s V o r g a n g d e r P a a r e s i c h
b e w e g t , d. h. d e r W in k e l , um d e n d a s l in k e u n d r e c h t e Z e l le .n p a a r in d e r
t y p i s c h e n E n d k o n f i g u r a t i o n d i v e r g i e r e n .
Diese letztere Notwendigkeit ruft uns ein früheres Ergebnis in die Erinnerung. Um
die schiefe Spindelstellung der beiden hinteren Ektodermzellen b und ß unter typischen wie
abnormen Verhältnissen zu erklären, nahmen wir an (p. 142), daß in jeder von beiden Zellen
eine schiefe, zur primären Medianfläche aber senkrechte Ebene strukturell hervorgehoben
sei. Und zwar mußten die Richtungen der beiderseitigen Strukturebenen, da ja die Spindeln
am typisch entwickelten Embryo gleichgerichtet sind, normalerweise — trotz der Asymmetrie
des linken und rechten Zellenpaares — zusammenfallen. Hieraus aber folgte zugleich, daß
v o r der Umordnung des vierzelligen Ektoderms die s c h i e f e n S t r u k t u r e b e n e n v o n b
u n d ß um d e n s e l b e n s p i t z e n W i n k e l d i v e r g i e r t e n , d e r n a c h A b l a u f d e r
O r i e n t i e r u n g zw i s c h e n d em l in k e n u n d d em r e c h t e n Z e l l e n p a a r e b e s t e h t . —
Nun hat sich mittlerweile herausgestellt, daß die im Plasma differenzierten „Ebenen“ , die
wir im Kapitel der Teilungsrichtungen für viele Zellen gefordert hatten, durchweg in Wahrheit
„Schichtsysteme“ sind, und es liegt aus Gründen der Gleichartigkeit überaus nahe,
auch mit den schiefen Strukturebenen von b und ß eine solche Umdeutung vorzunehmen.
So erhalten wir für beide hinteren Zellen des Ektoderms je ein schräges, zur Medianebene
senkrechtes Schichtsystem, das in der quadratisch-horizontalen, Anfangsstellung mit dem der
Gegenseite sich unter spitzem Winkel kreuzt, nach vollzogener Umordnung aber gleichgerichtet
von einer Flanke zur ändern übergeht. Allein wir glauben nach neueren Erg eb nissen
nicht mehr, daß eine solche Schichtung, die ja im Plasmaleib des Keimes schon
lange vor der räumlichen Isolation der betreffenden Zelle bestanden haben muß, genau
und ausschließlich auf den Bereich jener Zelle beschränkt sein könnte; sondern die schrägen
Schichtsysteme, die den Spindeln von b und ß ihre Richtung geben, werden wohl auch
in den zwei vorderen 'Ektodermzellen vorhanden sein (Fig. L L L L - 1).
Man sieht, die La ge ist für die wohlfeile Beschaffung der von uns benötigten Strukturen
wieder einmal eine äußerst günstige. W ir brauchen Schichtsysteme im linken und
rechten Ektodermzellenpaar, die in der horizontal - quadratischen Anfangsstellung derartig
Zoologloa. Heft 40. 29