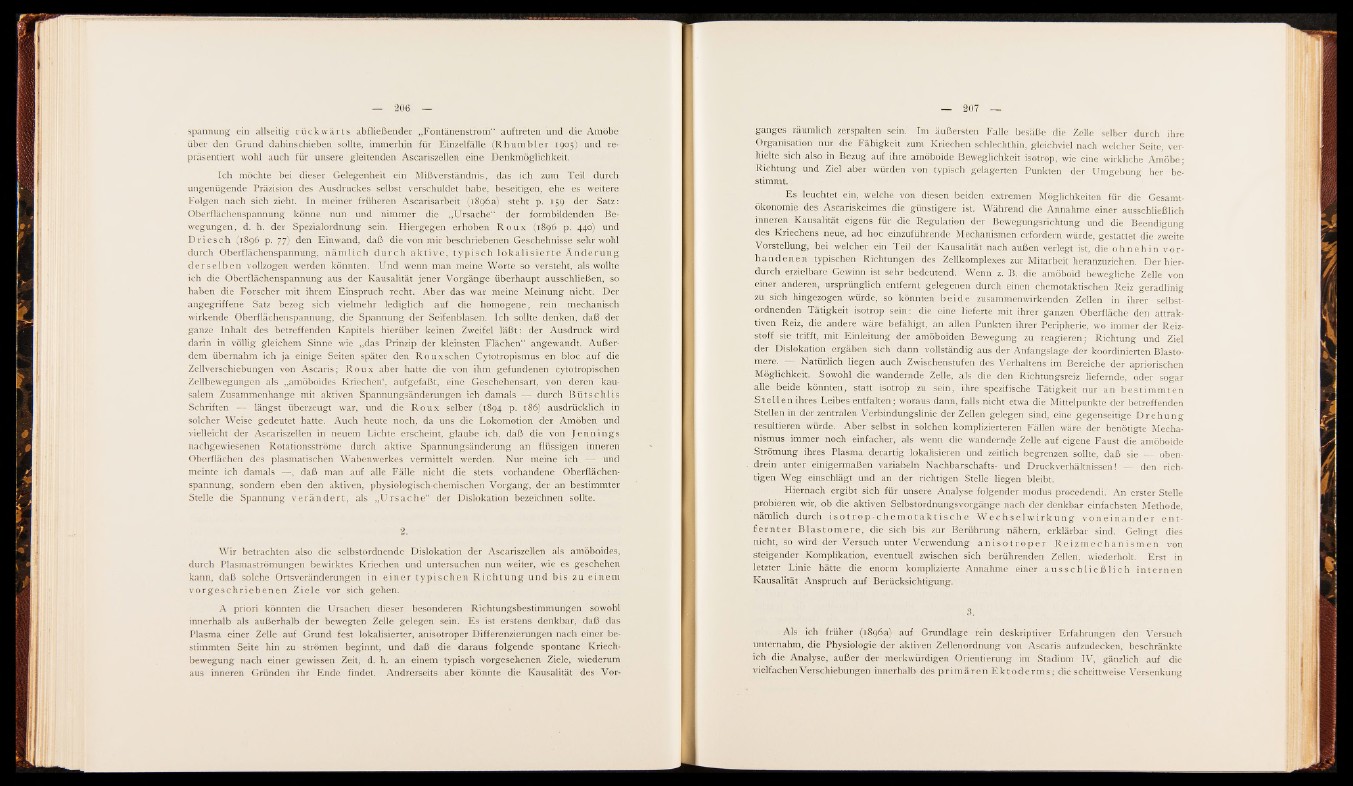
Spannung ein allseitig r ü c k w ä r t s 'a b f lie ß e n d e r „Fontänenstrom“ auftreten und die Amöbe
über den Grund dahinschieben sollte, immerhin für Einzelfälle (R h u m b le r 1905) und repräsentiert
wohl auch für unsere gleitenden Ascariszellen eine Denkmöglichkeit.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit ein Mißverständnis, das ich zum Teil durch
ungenügende Präzision des Ausdruckes selbst verschuldet habe, beseitigen, ehe es weitere
Folgen nach sich zieht. In meiner früheren Ascarisarbeit (1896a) steht p. 159 der Satz:
Oberflächenspannung könne nun und nimmer die „U rsach e “ der formbildenden B e wegungen,
d. h. der Spezialordnung sein. Hiergegen erhoben R o u x (1896 p. 440) und
D r i e s c h (1896 p. 77) den Einwand, daß die von mir beschriebenen Geschehnisse sehr wohl
durch Oberflächenspannung, n ä m l i c h d u r c h a k t i v e , t y p i s c h l o k a l i s i e r t e Ä n d e r u n g
d e r s e lb e n vollzogen werden könnten. Und wenn man meine Worte so versteht, als wollte
ich die Oberflächenspannung aus der Kausalität jener Vorgänge überhaupt ausschließen, so
haben die Forscher mit ihrem Einspruch recht. A ber das war meine Meinung nicht. Der
angegriffene Satz bezog sich vielmehr lediglich auf die homogene, rein mechanisch
wirkende Oberflächenspannung, die Spannung der Seifenblasen. Ich sollte denken, daß der
ganze Inhalt des betreffenden Kapitels hierüber keinen Zweifel lä ß t: der Ausdruck wird
darin in völlig gleichem Sinne wie „das Prinzip der kleinsten Flächen“ angewandt. A uße rdem
übernahm ich ja einige Seiten später den R o u x s c h e n Cytotropismus en bloc auf die
Zellverschiebungen von A scaris; R o u x aber hatte die von ihm gefundenen cytotropischen
Zellbewegungen als „amöboides Kriechen1, aufgefaßt“ eine Geschehensart, von deren kausalem
Zusammenhänge mit aktiven Spannungsänderungen ich damals — durch B ü t s c h l i s
Schriften — längst überzeugt war, und die R o u x selber (1894 p. 186) ausdrücklich in
solcher Weise gedeutet hatte. A uch heute noch, da uns die Lokomotion der Amöben und
vielleicht der Ascariszellen in neuem Lichte erscheint, glaube ich, daß die von J e n n i n g s
nachgewiesenen Rotationsströme durch aktive Spannungsänderung an flüssigen inneren
Oberflächen des plasmatischen Wabenwerkes vermittelt werden. Nur meine ich — und
meinte ich damals — , daß man auf alle F ä lle nicht die stets, vorhandene Oberflächenspannung,
sondern eben den aktiven, physiologisch-chemischen Vorgang, der an bestimmter
Stelle die Spannung v e r ä n d e r t , als „ U r s a c h e “ der Dislokation bezeichnen sollte.
Wir betrachten also die selbstordnende Dislokation der Ascariszellen als amöboides,
durch Plasmaströmungen bewirktes Kriechen und untersuchen nun weiter, wie es geschehen
kann, daß solche Ortsveränderungen in e in e r t y p i s c h e n R i c h t u n g u n d b i s zu e in em
v o r g e s c h r i e b e n e n Z i e l e vor sich gehen.
A priori könnten die Ursachen dieser besonderen Richtungsbestimmungen sowohl
innerhalb als außerhalb der bewegten Zelle gelegen sein. E s ist erstens denkbar, daß das
Plasma einer Zelle auf Grund fest lokalisierter, anisotroper Differenzierungen nach einer bestimmten
Seite hin zu strömen beginnt, und daß die daraus folgende spontane Kriechbewegung
nach einer gewissen Zeit, d. h. an einem typisch vorgesehenen Ziele, wiederum
aus inneren Gründen ihr Ende findet. Andrerseits aber könnte die Kausalität des V o r ganges
räumlich zerspalten sein. Im äußersten Falle besäße die Zelle selber durch ihre
Organisation nur die Fähigkeit zum Kriechen schlechthin, gleichviel nach welcher Seite, verhielte
sich also in Bezug auf ihre amöboide Beweglichkeit isotrop, wie eine wirkliche Amöbe;
Richtung Und Ziel aber würden von typisch gelagerten Punkten der Umgebung her bestimmt.
E s leuchtet ein, welche von diesen beiden extremen Möglichkeiten für die Gesamtökonomie
des Ascariskeimes die günstigere ist. Während die Annahme einer ausschließlich
inneren Kausalität eigens für die Regulation der Bewegungsrichtung und die Beendigung
des Kriechens neue, ad hoc einzuführende Mechanismen erfordern würde, gestattet die zweite
Vorstellung, bei welcher ein T e il der Kausalität nach außen verlegt ist, die o h n e h in v o r h
a n d e n e n typischen Richtungen des Zellkomplexes zur Mitarbeit heranzuziehen. Der hierdurch
erzielbare Gewinn ist sehr bedeutend. Wenn z. B. die amöboid bewegliche Zelle von
einer anderen, ursprünglich entfernt gelegenen durch einen chemotaktischen Reiz geradlinig
zu sich hingezogen würde, so könnten b e id e zusammenwirkenden Zellen in ihrer selbstordnenden
Tätigkeit isotrop sein: die eine lieferte mit ihrer ganzen Oberfläche den attraktiven
Reiz, die andere wäre befähigt, an allen Punkten ihrer Peripherie, wo immer der Reizstoff
sie;,-trifft, mit Einleitung der amöboiden Bewegung zu reagieren; Richtung und Ziel
der Dislokation ergäben sich dann vollständig aus der Anfangslage der koordinierten Blastomere.
Natürlich liegen auch Zwischenstufen des Verhaltens im Bereiche der apriorischen
Möglichkeit. Sowohl die wandernde Zelle, als die den Richtungsreiz liefernde, oder sogar
alle beide könnten, statt isotrop zu sein, ihre spezifische Tätigkeit nur a n b e s t im m t e n
S t e l l e n ihres Leibes entfalten; woraus dann, falls nicht etwa die Mittelpunkte der betreffenden
Stellen in der zentralen Verbindungslinie der Zellen gelegen sind, eine gegenseitige D r e h u n g
resultieren würde. A ber selbst in solchen komplizierteren Fällen wäre der benötigte Mechanismus
immer noch einfacher, als wenn die wandernde Zelle auf eigene Faust die amöboide
Strömung ihres Plasma derartig lokalisieren und zeitlich begrenzen sollte, daß sie obendrein
unter einigermaßen variabeln Nachbarschafts- und Druckverhältnissen! — den richtigen
W e g einschlägt und an der richtigen Stelle liegen bleibt.
Hiernach ergibt sich für unsere Analyse folgender modus procedendi. An erster Stelle
probieren wir, ob die aktiven Selbstordnungs Vorgänge nach der denkbar einfachsten Methode,
nämlich durch i s o t r o p - c h e m o t a k t i s c h e W e c h s e lw i r k u n g v o n e i n a n d e r e n t f
e r n t e r B l a s t o m e r e , die sich bis zur Berührung nähern, erklärbar sind. Gelingt dies
nicht, so wird der Versuch unter Verwendung a n i s o t r o p e r R e i z m e c h a n i s m e n von
Steigender Komplikation, .eventuell zwischen sich berührenden Zellen, wiederholt. Erst in
letzter Linie hätte die enorm komplizierte Annahme einer a u s s c h l i e ß l i c h in t e r n e n
Kausalität Anspruch auf Berücksichtigung.
. 3.
Als ich früher (1896 a) auf Grundlage rein deskriptiver Erfahrungen den Versuch
unternahm, die Physiologie der aktiven Zellenordnung von Ascaris aufzudecken, beschränkte
ich die Analyse, außer der merkwürdigen Orientierung im Stadium IV, gänzlich auf die
vielfachen Verschiebungen innerhalb des p r im ä r e n E k t o d e rm s ; die schrittweise Versenkung