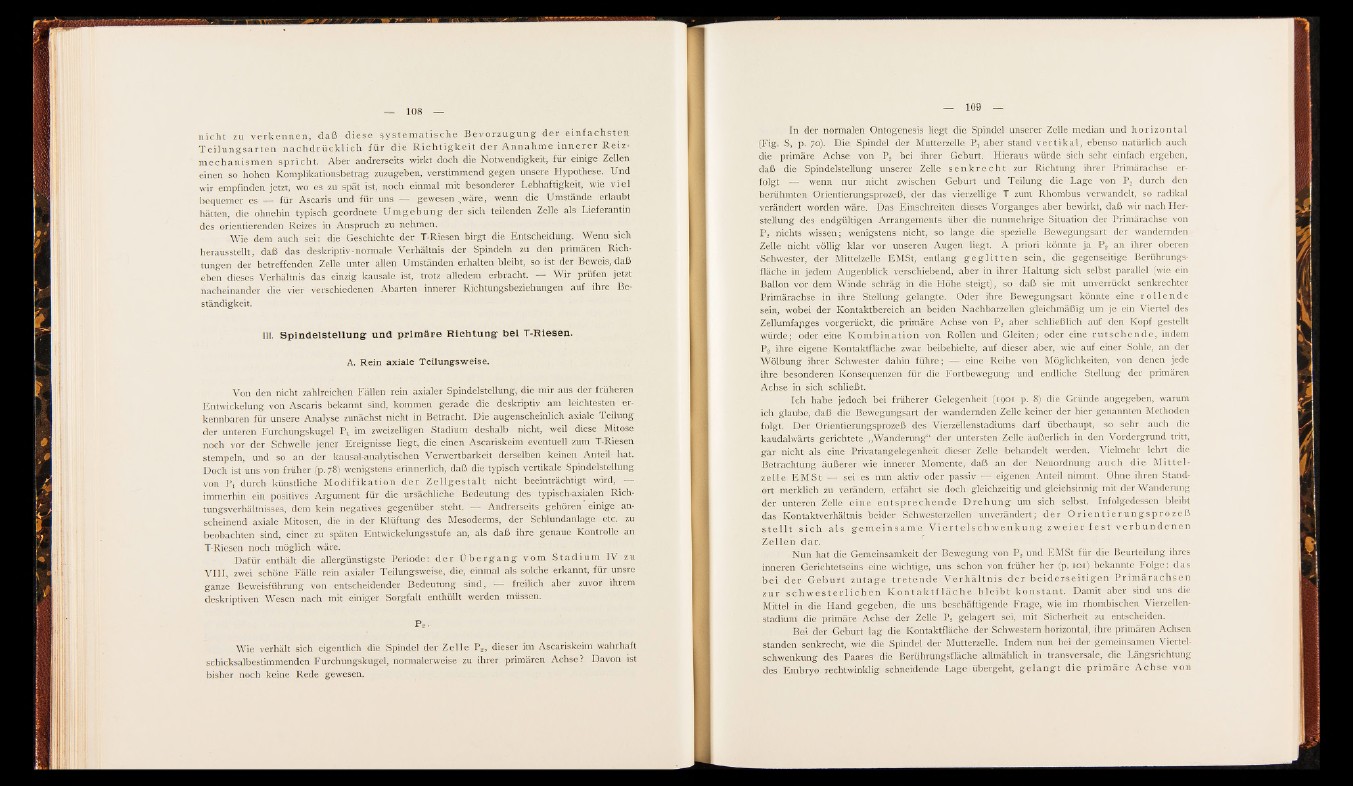
n i c h t zu v e r k e n n e n , d a ß d i e s e s y s t e m a t i s c h e B e v o r z u g u n g d e r e in f a c h s t e n
T e i l u n g s a r t e n n a c h d r ü c k l i c h fü r d ie R i c h t i g k e i t d e r A n n a h m e i n n e r e r ReiäZü
m e c h a n i sm e n s p r i c h t . A ber andrerseits wirkt doch die Notwendigkeit, für einige Zellen
einen so hohen Komphkationshetrag: zuzugeben, verstimmend gegen unsere Hypothese. Und
wir empfinden jetzt, wo efiizu spät ist, noch einmal mit besonderer Lebhaftigkeit, wie v i e l
bequemer esi Î# für Ascaris und für u n s g lB gewesen ,wârë y i wenn die Umstände erlaubt
hätten, die ohnehin typisch geordnete U m g e b u n g der sich teilenden Zelle als Lieferantin
des orientierenden Reizes in Anspruch zu nehmen.
W ie dem auch sei: die Geschichte der T-Rieseh birgt..die Entscheidung. Wenn sich
heraüsstellt, d aß das deskriptiv-normale V e rh ä ltn is der Spindeln zu den primären Richtungen
der i betreffenden Zelle unter allen Umständen erhalten bleibt, so ist.iJÿidBeweis, daß
eben dieses 'Verhältnis das einzig kausale ist, trotz alledem erbracht. ■■ W ir prüfen gjgfzt
nacheinander die vier verschiedenen Abarten innerer RichtungäWjriehängett auf -ihre Be--,
ständigkeit.
III. S p in d e ls te llu n g * u n d p r im ä r e Richtung * b e i T-Riesen.
A. Rein axiale Teilungsweise.
V on den nicht zahlreichen Fällen: Srein axialer Spindelstellung, die mir aüs der' itüheren
Entwickelung von Ascaris bekannt sind, kommen gerade die deskriptiv am leichtesten erkennbaren
für unsere Analyse zunächst nicht in Betracht. Die augenscheinlich axiale Teilung
d e r unteren Fürchüngskugel P , im zweizeiligen .Stadium deshalb |jjicht,: weil diese Mitosd
noch vor der Schwelle jener Ereignis^: liegt, die einen Ascariskeim eventuell zum T-Ritt#|i
stempeln, und so an der kausal-analytischen Verwertbarkeit derselben keinen Anteil- hat.
Doch, ist uns von f r ü h e r fp.^«) wenigstens erinnerlich, daß die typisch vertikaiiASpinâélsfellung
von P , durch künstliche M o d i f i k a t i o n d e r i f e l l g e s t a l t nicht beeinträchtigt, wird, — ■
■immerhin ein positives Argument für die ursächliche Bedeutung île s ! typisehraxialen Richtungsverhältnisses,
dem kein negatives gegenüber,-steht. E ' Andrerseits gehören--einige1, anscheinend
axiale Mitosen, die in der Klüftung. .des.-Mesoderms, .derî'ÿchlundanlagecètç, zu
beobachten sind, einer zu späten Entwickelüngsstufe a n ^ ils ! daß ihre genaupi-¡Kontrolle an
T-Riesén noch möglich wäre.
Dafür enthält die allergünstigste Periode: d e r , Ü b e r g a n g v om S t a d i u m IV zu
V I I I , zwei schöne Fälle rein ax ia ler’ Teilungsweise, die, einmal als solche erkannt, für unsre
ganze Beweisführung von entscheidender Bedeutung sind, — freilich aber zuvor ihrem
deskriptiven Wesen nach mit einiger Sorgfalt enthüllt werden müssen.
P2 •
W ie verhält sieh eigentlich die Spindel der Z e l l e PA- dieser : im Ascariskeim wahrhaft
schicksalbestimmenden Furchungskugel, normalerweise zu ihrer primären Achse? Davon ist
bisher noch keine Rede gewesen. -
ln d.er,normalen Ontogenesis liegt die Spindel unserer Zelle median und h o r i z o n t a l
(Fig. S, p. 70). D ie Spindel der Mutterzelle P , aber stand v e r t i k a l , ebenso natürlich auch
die primäre Achse von P . bei ihrer Geburt. Hieraus würde sich sehr einfach ergeben,
daß die S>indelstelfang unserer /.»Ec' h e n k r e c h t zur Richtung ihrer Primärachse erfolgt
3 wennWnir nicht zwischen Igfeburt und Teilung die. La g e von P2 durch den
berühmten Oriontierungs.prwze:ß, der'-das vierzeilige T zum Rhombus verwandelt, so radikal
verändert .worden wäre. D jjlE in s ch re iten dieses Vorganges aber bewirkt, daß. wir nach Herstellung
des endgültigen Arrangements über die nunmehrige Situation der Primärachse von
P. IV,-Ins -wissen •. wenipslens nicht. Bt) lange- die spezielle -Bewegungsart der wandernden,,
Ztelle nicht völlig klar vor unseren Augen liegt. A priori könnte IS.. P„ an ihrer oberen
■Schwester, der Mittel/eile i. EM St, entlang g e g l i t t e n sein, die gegenseitige Berührungsfläche
in. jedem Augenblick verschiebend, aber in ihrer Haltung sich selb|t; .parallel (wie ein
Billion vor dem Winde schräg in die Höhe ;s t i|Ä J |§ |q ; daß sie mit unverrückt senkrechter
Primätäjähse in ihre Stellung ¡-gelangte. Sg ä *» ihre Beweguiigsart, könnte eins r o l l e n d e
sein, wobei der Kontaktbereich. an b e iä% Nachbärzellen gleichmäßig um je ein Viertel des
Zellumfapges vorgerückt, die primäre-‘Achse A o n P2 aber * schließlich auf den Kopf gestellt
würde? oder B i f f j K o m b in a t io n -von Rollen und Gleiten; oder eine r u t s c h e n d e , indem
P 2 ihre eigene Kontaktfüiche zwar, beibehielic-, auf tiiescr aber, wie -auf einer SphlKylau der
Wölbung ihrer §|chw.ester dahin führe eine Reihe von Möglichkeiten,' von denen jede
ihre besonderen Kprtsf-dkenzett für die Fortbewegung und endliche. Stellung der primären
Achslp in sich ¡schließt.-’
Ich habe 'jedoch bei früherer Gelegenheit f | jö i p .Ä die Gründe angegeben, warum
ich glaube, daß die Bewegungsart der Wandernden Zelle keiner der hier genannten Methoden
folgt. Der ¡Drien'.ierungsprozoß rd i l | Vierzeüe.nstauiums darf überhaupt, so. sehr auch die
kaUdalwärtfcgOJ ichtetei „Wanderung’’ der untersten.-Zelle au § e rh e ll in den Vordergrund tritt,
g ar nicht-tal«. eine Privatangelegenheit diesereZelle b eh ande lt.-werden. Vielmehr lehrt die
Betrachtung-äußerer wie innerer!Momente, daß an der i-Neuordnung a u c h d ie M i t t e l -
z .c lle E M S tH B g j s l s . 'n u n aktiv oder-passiv - eigfäien Anteil nimmt, Ohne iiucn Standort
merklich zu Verändern, erfährt siq< doch, gleiohzfeitigiundiglbichsinnig mit der Wanderung
der unteren Zelle e in e e n t s p r e c h e n d e D r e h u n g um sich selbst. Infolgedessen bleibt
das Kontaktverhältnis-. beider HchwcSterzellen unverändert’? d e r O r i e n t i e r u n g s p r o z e ß
s t e 1 1 1 s i c h a l s g e 111 e i 11 s am e V i e r t e l . s e h w e n k u n g zw .e ie r f c s t v e r b u n d e n e n
Z e l l e n d a r .
Nun hat die Gemeinsamkeit-deiy-Bewegung von P2 und-EMSt für die Beurteilung ihres
inneren Gerichtetseins eine wichtige; uns schon von früher her- (pr io;i'»ibekannie F o lge ! d a s
b e i d e r G e b u r t z u t a g e t r e t .e in d s e .V e r h ä l tn iS id e r b - e id e r - s e it ig e n P r im ä r a c h s e n
z u r s c h w e s t e r l i c h e n K o n t a k t f l ä c h e b l e i b t k o n s t a n t . Damit aber sind uns die
Mittel in die Hand gegeben, die uns beschäftigende Frage, wie im rhombischen Vierzellen-
Stadiumi die primäre Achse der Zelle P , gelagert, sei, mit,iSicherheit zu entscheiden.
Bei der Geburt la g die Kontaktfläche der Schwestern horizontal, ihre primären Achsen
ständen senkrecht, wie-edie .Spindei der Mutterzelle. Indem nun ¡bei der-gemeinsamen Viertelschwenkung
des P a a re s 'd ie Berührungsfläche allmählich im transversale, d i e ’Längsrichtung
des Embryo rechtwinklig! schneidende-, La g e übergeht, ¡ g e la n g t d ie ■primäre A ch s -e Von